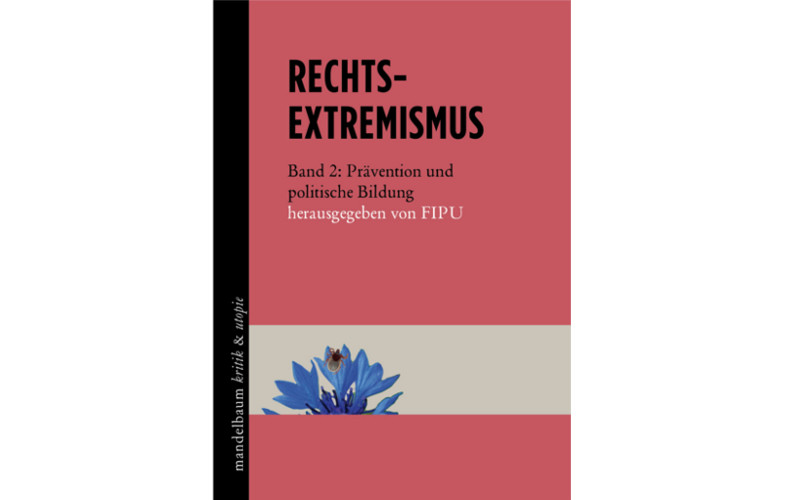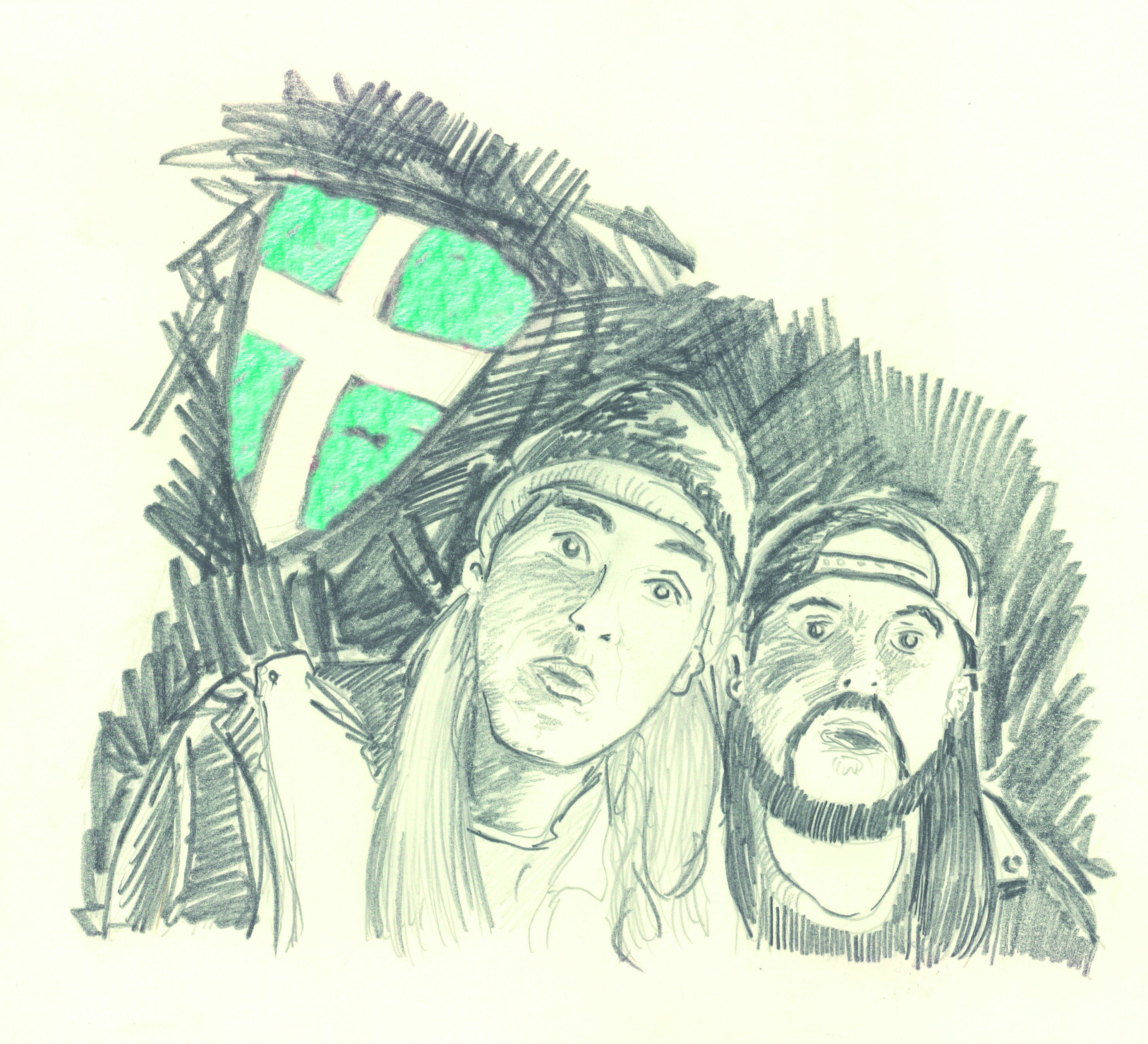Die Studienjahre sind angeblich die schönste Zeit des Lebens. Doch wenn Geld für die Miete fehlt, bleibt wenig Zeit zum Nietzsche-Lesen oder Bier-Pong-Spielen. Viele sind daher auf Studienbeihilfe angewiesen – Garantie gibt es keine. Über ein System, das in seinem Regelwerk zu ersticken droht.
Zwischen 350 und 450 Euro kostet ein Zimmer
in Wien, das heute unter die Bezeichnung „Normalpreis“ fällt. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Ungefähr 15 bis 25 Quadratmeter Wohnraum hat man dann ganz für sich. Der Rest, also Bad, Toilette und Küche, wird geteilt – mindestens mit einer weiteren Person. 475 Euro beträgt der Maximalbetrag an Studienbeihilfe für Studierende, die nicht am Wohnort ihrer Eltern leben. Daraus ergibt sich eine einfache Rechnung: In einem Monat mit günstigstem Mietpreis und höchster Studienbeihilfe bleiben dann bestenfalls 125 Euro zum Leben. Skripten, Nahrungsmittel, Semesterticket sind da noch zu bezahlen. Auch mit einem Platz im Studierendenheim um etwa 300 Euro wäre ein Studileben so nicht finanzierbar. Und dabei ist den Höchstbetrag an Beihilfe zu erhalten eher Wunschtraum als Realität.
Von Seiten der Stipendienstelle heißt es dazu, dass die Studienbeihilfe keine Finanzierung des Studiums sei, sondern eine Unterstützung, die dazu beitragen solle, den Lebensunterhalt zu sichern. 2013/14 reichten 60.658, also 16 Prozent aller Studierenden, einen Beihilfeantrag ein. Für junge Menschen, die am Wohnort der Eltern studieren, beträgt die Höchststudienbeihilfe 424 Euro im Monat. Studierende, die nicht am Wohnort der Eltern studieren, Vollwaisen, verheiratete oder verpartnerte Studierende, Studierende mit Kind und Studierende, die sich vor Studienbeginn vier Jahre selbst erhalten haben, bekommen höchstens 606 Euro. Davon wird allerdings noch die Familienbeihilfe abgerechnet, wenn sie bezogen wird. Auch abgezogen werden die „zumutbaren Unterhaltsleistungen“ der Eltern oder (Ehe-)Partner_innen beziehungsweise die Alimentenansprüche. Studierende mit erheblichen körperlichen Beeinträchtigungen bekommen einen Zuschlag, ebenso wie Studierende mit Kind, wenn sie die Sorgepflicht haben. Dieser Betrag wird dann um zwölf Prozent erhöht, um die Höhe der Studienbeihilfe zu errechnen. Die Höchststudienbeihilfe beträgt real entweder 475 oder 679 Euro. Im Jahr 2013/14 haben 6,4 Prozent der Studierenden diese erhalten.

RECHTSANSPRUCH MACHT NICHT SATT. Doch selbst von einem Mindestmaß an Beihilfe können manche Studierende nur träumen. So auch Julian Hofmayr: Der 23-Jährige studiert Biologie im achten Semester und hat in seinem ersten Semester Studienbeihilfe beantragt. Bekommen hat er nichts, nur einen Brief mit der Information, dass Beihilfen unter fünf Euro nicht ausgezahlt werden. Damals war er verzweifelt: „Ich habe angesucht und bin davon ausgegangen, dass ich aufgrund der gesamten Situation Beihilfe bekomme. Vor allem, weil der Studienbeihilfenrechner im Internet angezeigt hat, dass ich Anspruch auf ein paar hundert Euro hätte.“ Er rief bei der Stipendienstelle an und es wurde ihm gesagt, sein Vater würde zu viel verdienen, wenn auch nur sehr knapp, 20 Euro nämlich. Julians Eltern leben getrennt. Von seinem Vater bekommt er 450 Euro Alimente, damals, im ersten Semes
ter, waren es 400. Für ihn ist die Berechnung der Stipendienstelle nicht nachvollziehbar: „Es zählte im Grunde das Einkommen meines Vaters. Dass meine Mutter kein Einkommen hat, wurde nicht berücksichtigt. Ich hab’ es aber nicht noch einmal versucht, weil mir klar zu verstehen gegeben wurde, dass ich einfach nichts bekomme.“
Julian jobbt daher im Bauhaus, um über die Runden zu kommen. Seine Situation ist keine Ausnahme. Die gerichtlich festgesetzten Alimente werden von der Höchststudienbeihilfe abgezogen. Auch die Familienbeihilfe, die Julians Mutter für ihn bezieht, wird abgezogen. Von den 606 Euro, die ihm zustehen würden, bleibt dann nicht mehr viel übrig. Die Hälfte der Familienbeihilfe überlässt er ohnehin seiner Mutter. Doch selbst wenn er die Familienbeihilfe und Alimente zur Gänze bekommen würde, 600 Euro würden nicht zum Leben reichen.
Suzana Stojanovic vom Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung weiß, dass sogenannte Scheidungskinder bei der Studienbeihilfe oft leer ausgehen. Wenn der unterhaltspflichtige Elternteil, in den meisten Fällen der Vater, die Alimente nicht zahlt, bleibt den Studierenden tatsächlich keine andere Möglichkeit, als den eigenen Vater zu klagen.
STUDIENEINGANGSKLAGE. Dass Eltern die gesetzlich vorgesehene Unterstützung, den Unterhalt, verweigern, trifft aber nicht nur Studierende mit getrennten Eltern. Ob Eltern das Studium ihrer Kinder unterstützen, hängt nicht nur vom Einkommen ab, sondern auch davon, welche Einstellung zum Studium und welche Beziehung sie zu den Kindern haben. Während manche Eltern gar nichts zahlen, finanzieren andere Eltern über den Pflicht- unterhalt hinaus die gesamten Lebenskosten ihrer studierenden Kinder. Wenn die Eltern genug verdienen, aber das Studium ihres Kindes nicht unterstützen wollen, bleibt der Gang zum Gericht der einzige Ausweg. Das ist natürlich für viele undenkbar, daher verzichten viele Studierende lieber auf ihren gesetzlichen Anspruch und darauf, ihre eigenen Eltern zu klagen, und finanzieren sich – ohne Studienbeihilfe – das gesamte Studium selbst. Oft fällt dann sogar die Familienbeihilfe weg, weil sie von den Eltern bezogen wird. „Mit 18 Jahren ist man volljährig“, sagt Stojanovic, daher sei es absurd, als Studierende_r noch von der Willkür der Eltern abhängig zu sein.
Aus diesen Gründen sieht zum Beispiel die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ein Problem darin, dass die Studienbeihilfe an das Einkommen der Eltern gekoppelt ist. Die ÖH fordert auch die Anpassung der Studienbeihilfe an die Mindestsicherung. Diese wird jährlich der Inflation angeglichen und beträgt heuer 828 Euro im Monat (Zum Vergleich: Die Armutsgrenze liegt bei 1.104 Euro monatlich.), während die Studienbeihilfe nur alle paar Jahre angepasst wird, zuletzt 2007. Sie macht nur wenig mehr als die Hälfte der Mindestsicherung aus. „Das Gesetz erkennt bei der Mindestsicherung an, dass ein Mensch 828 Euro zum Leben braucht und Studierende bekommen höchstens 475 Euro. Das ist ein Widerspruch in sich“, meint Stojanovic.
STEMPELKISSENWEITSPRINGEN. Zahlreiche Undurchsichtigkeiten, die die Zuteilung und das Ausmaß der Unterstützung betreffen, begleiten den Weg durch das bürokratische Wirrwarr. Die 21-jährige Helene Friedinger meint: „Nur mit der Studienbeihilfe würde ich nicht über die Runden kommen. Deswegen muss ich nebenbei auch noch arbeiten.“ Sie studiert im sechsten Semester Musikwissenschaften an der Universität Wien. Seit vier Semestern ist sie nun auch für Bildungswissenschaften inskribiert. Studienbeihilfe bezieht sie nun für Letzteres, seitdem sie nach zwei Semestern ihre Beihilfe von Musik- auf Bildungswissenschaften ummelden hat lassen – pünktlich im befristeten Zeitraum bis Mitte Dezember des begonnenen dritten Semesters. Danach erhielt sie um 30 Euro im Monat mehr an Beihilfe, obwohl die Höhe der Förderung eigentlich immer zu Beginn des Wintersemesters neu berechnet wird und die Wahl des Studiums mit der Beihilfenhöhe eigentlich nicht zusammenhängt, wie die Stipendienstelle progress mitteilte. Dennoch erhält Helene seit ihrem „Wechsel“ also ganze 360 Euro mehr im Jahr, ohne dass sich außer einer Zeile in einem Formular irgendetwas geändert hätte.

Der Kalender der 21-Jährigen ist voll: Uhrzeiten über Uhrzeiten, in vielen verschiedenen Farben markiert, reihen sich aneinander. Termine für Seminare, Vorlesungen, Gruppentreffen, abzugebende Haus- und Seminararbeiten – multipliziert mit dem Faktor zwei: für ihre beiden Studienfächer natürlich. Daneben bleibt wenig Zeit für anderes. Doch diese übrige Zeit muss die Studentin nutzen, um ihre Lebensgrundlage zu sichern: 35 bis 40 Stunden im Monat arbeitet sie als persönliche Assistentin, nebenbei noch etwa vier Stunden pro Woche als Babysitterin. Das ist der Preis, den es zu zahlen gilt, wenn das Interesse über mehr als eine Studienrichtung hinausgeht.
Denn gerade für Studierende mit Doppelstudium wird es nach Abschluss des Bachelors für den Erhalt der Studienbeihilfe schnell kompliziert: Zwischen Ende des Bachelors und dem Beginn des Masterstudiums dürfen nämlich nur 30 Monate liegen. „Die Gesetzgeberin will damit erreichen, dass nur Studierende mit Studienbeihilfe gefördert werden, die das weiterführende Studium auch rasch und zielstrebig aufnehmen“, erklärt die Stipendienstelle auf Nachfrage. Verlängert werden diese Fristen nur in Ausnahmefällen, etwa aufgrund eines Auslandssemesters, einer Schwangerschaft oder des Zivildienstes. Problematisch wird ein solcher Stichtag aber vor allem bei Studierenden mit zwei Studienfächern, die für das eine Studium Beihilfe beziehen und nach dessen Abschluss erst das zweite beenden. Bis das Masterstudium begonnen werden kann, sind 30 Monate dann oft schon vorbei – und damit der Anspruch auf Unterstützung. Da laut der Studierendensozialerhebung von 2011 über 60 Prozent der Studierenden arbeiten, kommen diese unter Zeitdruck. Denn jede_r Zehnte gab an, über 35 Stunden pro Woche erwerbstätig zu sein – ein Umstand, der zu einer erheblichen Studienzeitverlängerung führt. Zusätzlich kann in dieser Zeit auch die Bereitschaft, ein neues Studium mit all dem einhergehenden bürokratischen Ballast anzufangen, sinken.
Die Regelungen des Beihilfensystems gehen also an der studentischen Lebensrealität komplett vorbei. Der Leistungsdruck an den Universitäten steigt und ein Studium in Mindeststudienzeit ist – auch ohne Nebenjob – kaum noch zu schaffen. Für den Bezug der Beihilfe wird aber ein positiver Studienerfolg von 30 ECTS im ersten Jahr erwartet. Gerade weil die Beihilfe den Lebensunterhalt nicht sichert und viele Studierende arbeiten gehen müssen, ist sie als fehlgeschlagene Maßnahme zu beurteilen.
GEHEIMGÄNGE. Besonders schwer haben es ausländische Studierende bei der Beantragung von Studienbeihilfe. Auch die Studienbeihilfenbehörde selbst kann dazu keine genauen Auskünfte geben. Gilbert Gmoyen vom ÖH-Referat für ausländische Studierende der TU Wien erzählt: „Die Beratung wird immer schwieriger, weil sich die gesetzlichen Regelungen ständig ändern und nie klar ist, was der aktuelle Stand ist.“ Selbst von der Stipendienstelle Wien bekommt progress die Antwort, dass zur Anspruchsberechtigung ausländischer Studierender keine Auskünfte erteilt werden könnten, weil die jetzigen Regelungen vermutlich bis zur kommenden Antragsfrist im Herbst nicht mehr aktuell sein würden. Studierende aus dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Beihilfe, eingeschränkt gelten diese auch für türkische Studierende. Student_innen aus anderen Ländern gehen leer aus, es sei denn, sie verfügen über die „Daueraufenthaltskarte EU“.
FAMILIEN(UN)RECHT. Christina Trinkl erhält von der Stipendienstelle keine Beihilfe, obwohl ihre Eltern beide nicht genug verdienen und sie deshalb jeden Samstag zehn Stunden im Supermarkt an der Kasse und nebenher noch als Babysitterin arbeitet. Viele ihrer Studienkolleg_innen allerdings bekommen eine Beihilfe und das obwohl deren Eltern mehr verdienen als ihre eigenen. Zweimal hat sie es nun bereits probiert und immer eine einzeilige Ablehnung erhalten. „Ich verstehe einfach das System dahinter nicht“, sagt sie. Im nächsten Semester wird nun auch ihre Schwester zu studieren beginnen, dann wird sie es ein weiteres Mal versuchen – dieses Mal hoffentlich mit Erfolg. Denn die Anzahl und das Alter der Geschwister wird bei der Berechnung miteinbezogen, wenn diese selbst Studien- oder Familienbeihilfe beziehen oder bei den Eltern mitversichert sind, und wirkt sich günstig auf den Beihilfenanspruch aus. Umgekehrt wird die Studienbeihilfe gekürzt, wenn die Geschwister selbständig werden. Das war etwa bei Helene der Fall. Letztes Jahr begann ihr Bruder mit dem Zivildienst und ihre Schwester zu arbeiten. Dadurch erhielt die Studentin der Musik- und Bildungswissenschaften 70 Euro weniger im Monat als zuvor. Was Trinkl und Friedinger eigentlich dafür können, dass sie Geschwister haben, bleibt offen.
Ein weiteres, regelmäßig auftretendes Problem ist es, wenn Eltern in Pension gehen und eine einmalige Abfertigung bekommen. Dann fällt oft im gesamten nächsten Jahr der Anspruch auf Studienbeihilfe weg. Es zeigt sich auch in dieser Regelung wieder die starke Koppelung der Beihilfe an die Familie, die sehr bürokratisch und oft weltfremd ist.
SCHREIBTISCHKÄMPFE. „Studieren muss für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren sowie geringe Toleranzsemester stellen vor allem für Arbeiter_innenkinder und Studierende mit Kind oder anderen Betreuungsverhältnissen unüberwindbare Hürden dar. Ein sorgenfreies selbstbestimmtes Studileben ist also nur möglich, wenn man von zuhause unterstützt wird. Denn das Beihilfensystem ist schon lange kein soziales Auffangnetz mehr – die durchschnittliche Ausbezahlungshöhe beträgt laut Studierendensozialerhebung nämlich gerade einmal 230 Euro“, sagt Lucia Grabetz, die Sozialreferentin der ÖH-Bundesvertretung. Die ÖH fordert vom Staat, die Finanzierung der gesamten Ausbildung zu gewährleisten. Das sei seine Aufgabe und Pflicht und notwendig, da sonst nicht unterbunden werden kann, dass Bildung in Österreich „vererbt“ wird (vgl. Seite 14). Die Studienbeihilfenbehörde sieht das anders: Die Beihilfe sei eben nur eine Beihilfe.
„Gespräche des ÖH-Sozialreferats mit dem zuständigen Wirtschaftsministerium und der Stipendienstelle gibt es bereits regelmäßig und da bringt die ÖH ihre Änderungsvorschläge auch ein“, so Stojanovic. Bisher haben diese Gespräche allerdings wenig an den alten bürokratischen Regelungen gerüttelt. Die Behörde rät jedenfalls allen Studierenden einen Antrag zu stellen, weil aktuell auch viele, die eigentlich rechtlichen Anspruch darauf haben, gar keine Beihilfe beantragen. Der österreichische Weg eben: Bürokratie mit noch mehr Bürokratie bekämpfen, statt eine politische Lösung zu finden.
Katharina Gruber studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien.
Anne Schinko studiert Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien.