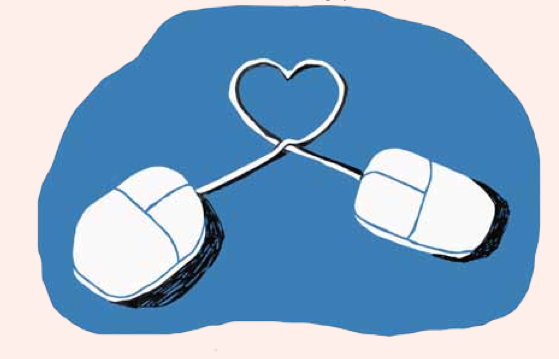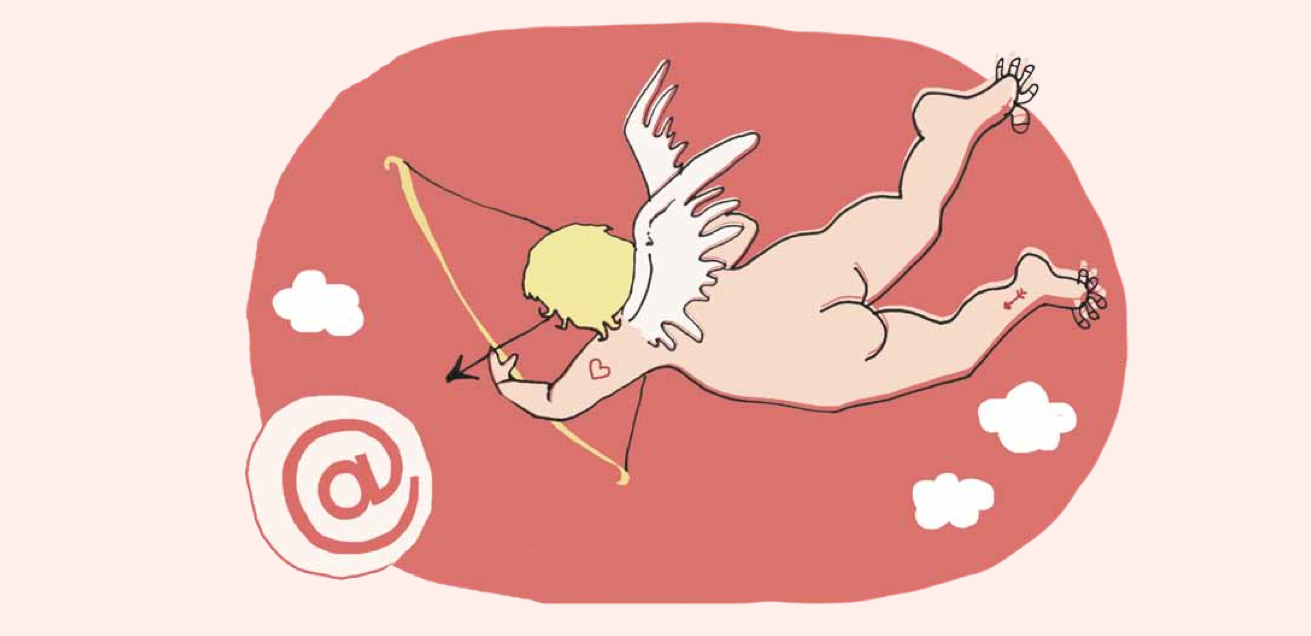Im letzten Teil des progress-Streitgesprächs der bundesweiten SpizenkandidaInnen Florian Lerchbammer (AG), Anna Lena Bankel (FEST), Florian Kraushofer (FLÖ), Marie Fleischhacker (GRAS), Claudia Gamon (JuLis) und Julia Freidl (VSStÖ) verraten die KandidatInnen ihre Koalitionswünsche, diskutieren über Beihilfenmodelle, Demokratie und darüber, wie die Institution ÖH eigentlich funktionieren soll. Die Fragen stellten Oona Kroisleitner und Georg Sattelberger.
progress: Auch zum Thema Beihilfen für Studierende finden sich bei allen Fraktionen Ideen und Änderungsvorschläge. Was sind eure Vorschläge?
Freidl: Das Beihilfensystem ist extrem löchrig, nur 15 Prozent aller Studierenden beziehen überhaupt konventionelle Studienbeihilfe. Das Beihilfensystem passt nicht mehr zu unserer Realität. Im Schnitt sind die Studierenden an unseren Unis 27 Jahre alt. Es macht also keinen Sinn, die Familienbeihilfe nur bis 24 auszubezahlen, vor allem auch für jene, die über den zweiten Bildungsweg an die Uni gekommen sind. Die starren Regeln Toleranzsemester betreffend, müssen gelockert werden. Es ist nicht Studierendenrealität ein Bachelorstudium in sieben Semestern abzuschließen. Ein dritter wesentlicher Punkt ist die Höhe der Beihilfen, die nicht mal annähernd auf dem Existenzminimum ist. Es werden etwa 300 bis 400 Euro durchschnittlich an Studienbeihilfe ausbezahlt. Die Studienbeihilfe ist seit 2008 nicht mehr an die Inflation angepasst worden. Studierende bekommen also jedes Jahr weniger an Beihilfen ausbezahlt.
Gamon: Wir wollen das Beihilfensystem an unser Modell des Bildungskredits koppeln. Auf der einen Seite sollen die Kosten für das Studium durch diesen Kredit gedeckt werden. Auf der anderen Seite denken wir, dass das Volumen an sozialen Beihilfen und Stipendien und auch Leistungsstipendien erhöht werden muss. Daran führt für uns kein Weg vorbei. Auch das Alter als Kriterium für den Beihilfenbezug ist für mich eine völlig willkürlich gewählte Grenze. Solange Menschen fleißig studieren und nachweisen können, dass sie studieren, finde ich es komplett irrelevant, wie lang sie das tun. Außerdem braucht es eine höhere Zuverdienstgrenze. Diese ist leistungsfeindlich und gehört auch sofort abgeschafft.
Fleischhacker: Die GRAS fordert ein Grundstipendium in der Höhe von 800 Euro, das für alle Studierende da sein soll, denn gerade wenn man Studiert, hat man hohe Lebenserhatungskosten. Das sieht man z.B daran, dass Studierende fast die Hälfte des Geldes, was sie zur Verfügung haben pro Monat, alleine für Wohnen ausgeben müssen. Zusätzlich müssen sie nebenher noch arbeiten und fallen dadurch schnell durch die Beihilfengrenzen. Gleichzeitig gibt es die Familienbeihilfe und die Stipendien, bei welchen man immer aufgrund des Einkommens der Eltern berechnet wird und das auch an die Eltern ausgezahlt wird.Wir sehen Studierende als junge Erwachsene, die selbst Teil der Gesellschaft sind und nicht nur auf ihre Eltern reduziert werden sollten – daher das Grundstipendium, damit man studieren kann ohne Hürden nebenbei.
Kraushofer: Ich denke, bei diesem Thema sind wir uns alle einig: Die Höhe der Beihilfen muss steigen, ja auf jeden Fall. Es muss möglich sein, egal wie lange man studiert, Beihilfen zu beziehen. Welche Art der Beihilfe es ist, sei es Grundstipendium, Familienbeihilfe oder Studienbeihilfe, wie man das nennen will, ist irrelevant. Es muss jedenfalls möglich sein, dass man es sich leisten kann zu studieren, wenn man das möchte.
Lerchbammer: Die Beihilfen müssen auf jeden Fall ausgebaut werden. Wir wollen sorgenfrei studieren können und uns nicht mit finanziellen Problemen herumschlagen müssen. Daher Familienbeihilfe bis 27, Evaluierung der Zuverdienstgrenzen, Studienbeihilfe ausweiten, aber auch Leistungsstipendien erhöhen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in der gesamten Diskussion ein wenig zu kurz gekommen ist. Dann müssen wir bei den anderen Ecken ansetzen, wo das Geld ausgegeben wird, wie zum Beispiel beim Wohnen oder Studierendentickets auf der Schiene.
Bankel: Die FEST fordert ebenso ein Grundeinkommen für Studierende. Dabei ist uns wichtig, dass das nicht mit dem Einkommen der Eltern in Verbindung gebracht wird. Weil nicht alle Studierenden in klassischen Familienverhältnissen leben. Grundsätzlich finden wir auch gut, wenn Studierende möglichst lange studieren können. Ein Grundeinkommen im Studium muss aber natürlich an Leistung im Studium gebunden sein und kann leider nicht bedingungslos sein.
progress: Ihr seid euch also weitgehend einig. Gibt es auch Kritikpunkte an den jeweils anderen Modellen?
Fleischhacker: Einen Kritikpunkt habe ich bei dem Modell der JuLis: Mit Krediten hat man wieder das Problem der Schulden.
Gamon: In unserem Modell ist es schon vorgesehen, dass zumutbar gestaltet wird, wie man das Geld zurückzahlt. Und auf der anderen Seite soll es eine staatliche Ausfallhaftung geben wenn die Schuld nicht komplett getilgt werden kann.
Freidl: Leistungsstipendien bekommt nur eine kleine, elitäre Gruppe an Studierenden. Die Unis können autonom entscheiden, wer ein Leistungsstipendium bekommt, es gibt nicht einmal einen Rechtsanspruch auf ein Leistungsstipendium. Deshalb finde ich nicht, dass das ein adäquates Mittel ist, um Studierende aus schlechter gestellten Schichten zu unterstützen.
Lerchbammer: Es geht darum, jene zu unterstützen, die eine Leistung erbracht haben und das auch zu fördern. Das ist doch eine gute Geschichte.
Freidl: Ich glaube, beim Beihilfensystem ist trotzdem ein wesentlicher Faktor, jenen Studierenden eine Hilfe zu geben, die es sich nicht leisten können. Es muss also so viel wie möglich in die Studierendenbeihilfe investiert werden. Leistungsstipendien sind eher etwas, das man der Studienbeihilfe zufließen lassen kann – anstatt denen, die schon genug Geld haben, noch mehr zu geben.
Kraushofer: Das Problem ist auch, dass Leistungsstipendien danach gehen, wie viele ECTS jemand erbringt und ob sehr viele Prüfungen erbracht werden können. Wenn man jetzt zu den Leuten gehört, die neben dem Studium arbeiten müssen, kann man auch nicht die große Masse an Prüfungen erbringen. Es wird einem privilegierten Menschen, der von den Eltern das Studium bezahlt bekommt, leichter fallen, möglichst viele ECTS mit möglichst guten Noten durchzudrücken. Ich will damit nicht sagen, dass Leistungsstipendien prinzipiell schlecht sind, aber so wie sie momentan geregelt sind, sind sie problematisch.

progress: Die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung ist vor den anstehenden Wahlen wieder ein umstrittenes Thema. Seit 2005 wird die Bundesvertretung der ÖH nur noch indirekt gewählt. Wann können Studierende mit einer Wahlrechtsreform rechnen?
Lerchbammer: Der Wahlmodus ist das eine, aber die Möglichkeit, dass jede und jeder Wählen kann, ist hier die viel drängendere Frage. Wie können wir sicherstellen, dass alle zur Wahl gehen können? Aktuell ist es nicht möglich, wenn jemand ein Auslandssemester macht oder an den drei Wahltagen gerade nicht an der Uni ist, dass diese Person an der Wahl teilnehmen kann. Daher ist die vorgelagerte Frage, wie schaffen wir es hier, dass alle Studierenden wählen gehen können?
Freidl: Bei dem Modell, dass von allen Fraktionen gemeinsam ausgearbeitet wurde und im bildungspolitischen Ausschuss einstimmig beschlossen wurde, war einerseits die Direktwahl von allen Hochschulorganen – Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Unis – vorgesehen. Um zu umgehen, dass Leute nicht vor Ort sein können, haben wir uns damals darauf geeinigt, einen alternativen Wahltermin anzubieten und beispielsweise die Möglichkeit zu schaffen im Ausland auf einer Botschaft wählen zu können. Damals hatte man sich eigentlich geeinigt. Deshalb finde ich es schade, dass immer die Briefwahl vorgeschoben wird.
progress: Soll es bei der nächsten ÖH-Wahl wieder eine Direktwahlmöglichkeit der Bundesvertretung geben können?
Gamon: Ich finde das jetzige Wahlrecht undemokratisch, weil eine Stimme von einer Uni mehr wert ist als von anderen. Das geht einfach nicht. Das war letztendlich nur eine Schikane gegen die damalige Exekutive, weil man ihr damit schaden konnte. Es ist auch relativ schnell umgesetzt worden. Jetzt war die Aktionsgemeinschaft dagegen und darum meinte der Minister, das könnte man nicht machen. Ich halte es für extrem schwierig, bei so einem wichtigen Thema ein anderes vorzuschieben. Ich bin auch für die Briefwahl, aber das hat in diesem Fall nichts miteinander zu tun. Es sind beides Aspekte einer Wahlrechtsreform, aber das eine ersetzt das andere nicht.
Lerchbammer: Wir als Aktionsgemeinschaft schlagen vor, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, wie man PHs, FHs und Privatunis bestmöglich in das System eingliedert. Und wie ermöglichen wir, dass jeder zur Wahl gehen kann? Wir verwehren uns überhaupt keinem Modus, wir wollen nur, dass unsere Bedenken ausgeräumt werden. Wir wollen vorher sichergestellt wissen, dass auch kleine Universitäten gehört werden, dass alle wählen gehen können und dass es eine klare Anzahl an Mandaten gibt – wir fordern hier 55. Das sind alles Themen, die wir behandeln müssen.
Fleischhacker: Es gibt ein Modell, wo all diese Sachen besprochen wurden, und all diese Fragen geklärt wurden. Das wurde im Bildungspolitischen Ausschuss der ÖH beschlossen und in einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet, wo auch von der AG VertreterInnen anwesend waren. Dann hat die AG beschlossen, dass sie das doch nicht wollen. Es gab dieses Modell. Ihr hättet ihm nur in der BV-Sitzung zustimmen müssen und euch nicht aus Feigheit jetzt davor drücken.
Kraushofer: Was wir damals beschlossen haben, war ein Konsenspapier. Alle konnten aufschreiben, was sie sich wünschen, dann wurde gestrichen, was jemandem nicht gepasst hat. Übrig blieb, was allen gepasst hat. Dafür gab es auch schon Zugeständnisse vom Ministerium, das war vor der letzten ÖH-Wahl. Ich werde jetzt sicher keine Briefwahl ausverhandeln, um dann nach der Wahl erst recht wieder keine Zusage zur Direktwahl zu bekommen.
Freidl: Das Problem bei dem letzten Vorschlag von der Aktionsgemeinschaft war die Forderung nach der Wahlkampfkostenrückerstattung.
Bankel: Die HSWO (Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlordnung, Anmk.) Reform, die hier nicht durchgeht (Konsenspapier, Anmk.) beinhaltet eben auch einen Punkt, der uns extrem wichtig ist: das ist das passive Wahlrecht für Drittstaatsangehörige. Das wird aufgehalten, dadurch, dass wir keine Reform angehen. Ich verstehe nicht, warum die Briefwahl so ein großes Thema ist. Wir haben eine niedrige Wahlbeteiligung, aber das liegt nicht daran, dass es keine Briefwahl gibt. Wer nicht persönlich mit dem niedrigsten Aufwand schnell mal seinen Studierendenausweis auf der Uni herzeigt und einen Zettel einschmeißt, der wird sich bestimmt nicht für die Briefwahl registrieren lassen. Außer es sind Funktionär_innen, die an mehreren Unis eingeschrieben sind und über Listenverbände so Mandate bekommen möchten. Sich so sehr dafür einzusetzen, das finde ich total verdächtig.
Lerchbammer: Wir sollten meiner Meinung nach eher darüber sprechen, wie man eine konstruktive ÖH gestaltet, bevor wir darüber sprechen, wie sie gewählt wird. Bei der Universitätsautonomie, der wir gegenüberstehen, spielt sich ein Großteil der Dinge, die uns betreffen, dort ab, wo wir Studieren. Die indirekte Wahl wertet die lokalen Vertretungen auf und stellt sicher, dass diese auch Stimmrecht in der Bundesvertretung haben.
progress: Wie könnte man garantieren, dass die kleinen Universitäten gut eingebunden werden?
Kraushofer: Alle Vorsitzenden von allen Universitäten werden zu den Sitzungen der Bundesvertretung eingeladen und haben Antrags- und Rederecht. Die Sichtbarkeit ist dadurch in jedem Fall gegeben. Weiters gibt es die Vorsitzendenkonferenz, die ebenfalls bei den BV-Sitzungen vertreten ist und Anträge stellen kann. Das einzige, was die kleineren Universitäten möglicherweise nicht mehr hätten, wäre Stimmrecht. Alles andere ist jedenfalls gegeben.
Lerchbammer: Aber genau darum geht es doch. Wir wollen Mitbestimmung kleinerer Universitäten
Kraushofer: Wenn ich auf meiner Uni aber jetzt gerne die eine Fraktion habe, aber in der Bundesvertretung eine andere, muss ich mich entscheiden, was mir wichtiger ist. Darum ist das eben keine qualitative Verbesserung der Stellung der Universitätsvertretungen.
progress: In manchen Wahlprogrammen wird die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft der ÖH und die Umgestaltung dieser gefordert. Was spricht für und was gegen die Pflichtmitgliedschaft?
Gamon: Wir als Liberale treten für eine freiwillige Interessensvertretung ein. Ich sehe das als Instrument, um der ÖH mehr Gewicht zu geben und die ÖH dazu zu bringen, sich um ihre Mitglieder zu bemühen. Eine Lobby, die alle Studierenden hinter sich hat, die sich dazu entschieden haben hinter der ÖH zu stehen und Mitglied zu bleiben, hat einfach politisch mehr Gewicht. Die geringe Wahlbeteiligung und Beteiligung der Studierenden in der ÖH führt letztendlich dazu, dass sie keine starke Lobby mehr ist.
Fleischhacker: Ich sehe es genau umgekehrt. Gerade dadurch, dass es eine Pflichtmitgliedschaft gibt und dass alle Studierenden ÖH-Mitglieder sind, bekommt die ÖH ein enormes Gewicht gegenüber dem Ministerium, in Verhandlungen in Unigremien oder mit dem Staat. Im Rest von Europa gibt es wenige Studierendenvertretungen, die so gut wie die ÖH aufgestellt sind. Es gibt keine einzige andere Studierendenvertretung, die auch rechtlich so gut abgesichert ist und die so viel für Studierende machen kann. Meist bestehen diese Vertretungen aus drei bis fünf Personen, die um ihr Büro und Termine mit dem Ministerium kämpfen müssen. Die Pflichtmitgliedschaft gibt der ÖH ein enormes Gewicht.
Freidl: Es ist wichtig, dass die ÖH unabhängig agieren kann und die gesetzliche Studierendenvertretung gegenüber dem Ministerium ist. Die Pflichtmitgliedschaft gewährleistet das.
Lerchbammer: Nur so kann die ÖH eine starke Gewerkschaft für Studierende sein. Wir verstehen aber auch die Stimmen, die sie abschaffen wollen. Die Frage ist nicht die Mitgliedschaft, sondern wie wir es schaffen, die ÖH konstruktiv zu gestalten. Wie schaffen wir es, dass die Studierenden einen Mehrwert in der Mitgliedschaft sehen und gerne bereit sind diese 17,50 Euro zu zahlen?
progress: Die AG fordert, dass ab einem Budget von 100.000 Euro Projekte vom Ministerium genehmigt werden sollen. Wie kann sichergestellt werden, dass die ÖH eine starke Vertretung bleibt?
Lerchbammer: Es geht grundsätzlich darum, dass wir so große Ausgaben von einer Aufsichtsbehörde per Bescheid genehmigen lassen wollen. Diese kann man wie eine Wahlkommission beschicken, damit sie auch unabhängig ist. Wenn dann per Bescheid ausgestellt wird, dass eine Ausgabe im Sinne des HSG ist oder nicht, kann ein zweites Café Rosa verhindert werden. Um sicherzustellen, dass etwas nicht aus politischer Motivation heraus verhindert wird, kann gegen den Bescheid berufen werden. Am Ende liegt die Frage beim Verwaltungsgerichtshof, der unabhängig ist.
Freidl: Aber wir haben bereits Beschlussgrenzen von 7.000 und 15.000 Euro, die ÖH wird geprüft, es gibt Ausschüsse, die Kontrollkommission und den Rechnungshof, die alle die ÖH kontrollieren. Die Beschlussgrenzen jetzt weiter nach oben zu setzen, finde ich lächerlich. Ich finde es wichtig, dass die ÖH unabhängig vom Ministerium agieren kann.
Kraushofer: Wenn man ein Kontrollgremium nicht nach ÖH-Mehrheiten beschickt, muss es vom Ministerium passieren. Dann muss man bei Klagen, wie jenen gegen die autonomen Studiengebühren, erst einmal warten, bis das Kontrollgremium einen Beschluss gefasst hat, wenn es abgelehnt wird, kann man erst vor dem Verwaltungsgerichtshof berufen. Das ist ein langer und mühsamer Weg
Lerchbammer: Es ist bei Ausgaben von über 100.000 Euro gerechtfertigt, dass man vier Monate Vorlaufzeit hat. Es geht nicht darum, die jetzigen Beschlussgrenzen anzutasten, sondern die Kontrollmöglichkeiten der Realität zupassen, da es nach wie vor möglich ist, mit einem rechtswidrigen Umgehungsgeschäft eine halbe Million Euro zu vernichten. Bereits jetzt werden Wirtschaftsbetriebe geprüft, besser ist aber ein absoluter Geldbetrag, der nicht von der Form des Geschäfts abhängt.
progress: Letzte Frage: Mit wem wollt ihr nach den Wahlen zusammenarbeiten und was ist das eine wichtigste Projekt eurer Fraktion?
Lerchbammer: Wir würden grundsätzlich mit allen koalieren, die gemeinsam mit uns Lösungen anbieten, denen Inhalte wichtiger sind als Ideologien. Wir wollen die nächsten zwei Jahre für mehr Qualität im Studium aufwenden. Wir setzen uns für Betreuungsverhältnisse und die Einbindung der Universitäten ins Transparenzgesetz ein. Wir wollen, dass jeder einen echten Studienplatz hat, durch eine Studienplatzfinanzierung und faire und transparente Zugangsregelungen. Wir wollen auch, dass es in Zukunft nicht mehr möglich ist, eine halbe Million Euro für ein umstrittenes Projekt auszugeben.
Kraushofer: Wir schließen prinzipiell nur den RFS aus, werden aber auch nicht in eine Koalition gehen, die Studiengebühren oder Zugangsbeschränkungen fordert. Mit der FEST können wir sehr gut, das wird sich aber nicht absolut ausgehen. Darum werden wir nach den Wahlen sehen, wer sonst noch zur Verfügung steht. Wir sind uns mit der AG einig, dass wir für mehr Qualität im Studium sorgen wollen, allerdings haben wir da andere Ansätze. Wir wollen uns weiterhin mit Qualitätssicherung und Studienrecht beschäftigen und uns dafür einsetzen, dass die Universitäten endlich ausfinanziert werden.
Freidl: Wir setzen uns für ein faires Beihilfensystem ein, damit studieren wieder für alle leistbar ist. Außerdem haben wir konkrete Projekte, die wir in der ÖH umsetzen wollen: einen Didaktik-Leitfaden, den wir gemeinsam mit Professor_innen, Expert_innen, Studierenden und Lehrenden herausbringen wollen, damit wir die Qualität der Lehre steigern können; ein Gütesiegel für Studierendenwohnheime, damit die Infrastruktur und das Preis/Leistungsverhältnis wieder passen. Wir wollen das Beratungsangebot ausbauen, zum Beispiel mit dem Vertragscheck. Nach den Wahlen werden wir sehen, mit wem wir diese Projekte am besten umsetzen können. Klar ist, dass wir den RFS ausschließen, er steht weit rechts ist nicht mit unseren Grundsätzen vereinbar.
Fleischhacker: Wir wollen ein „Studium-Generale“ für mehr Orientierung an den Unis. Im Bereich Wohnen fordern wir die Abschaffung der Vergebührung der Mietverträge, sowie einen Aus- und Neubau von Studierendenwohnheimen. Im Bereich Mobilität wollen wir Gratis-Öffis, Fahrradwege und –abstellplätze an den Unis selbst. Ein wichtiger Bereich für uns ist auch jener der Barrierefreiheit an den Hochschulen. Wir schließen den RFS, die AG und die JuLis aus, weil wir für einen freien und offenen Hochschulzugang stehen.
Gamon: Wir schließen generell niemanden aus, das finde ich demokratiepolitisch nicht okay. Wir kommen mit rechts- und linksextremen Fraktionen aber ob ihrer Ideologie nicht zusammen. Die JuLis heben sich inhaltlich von der Masse ab, daher glaube ich nicht, dass wir uns – egal in welcher Koalition – sofort für nachgelagerte Studiengebühren einsetzen würden. Das wäre etwas überheblich. In einer Koalition wollen wir uns dafür einsetzen, dass es Bewegung gibt. Das hat mir in den letzten zwei Jahren gefehlt. Man war sehr damit beschäftigt Dinge zu bekämpfen und hat keine Zeit mehr gefunden, sich für etwas Positives einzusetzen.
Bankel: Wir als FEST finden, dass die letzten vier Jahre gut funktioniert haben und können uns vorstellen, dass wir auch weiter zusammen arbeiten. Uns ist eine inhaltliche Überschneidung mit Koalitionspartner_innen sehr wichtig, aber auch dass sauber gearbeitet wird, wenn es um Finanzgebarung und Auftragsvergabe geht.