Pandazeit
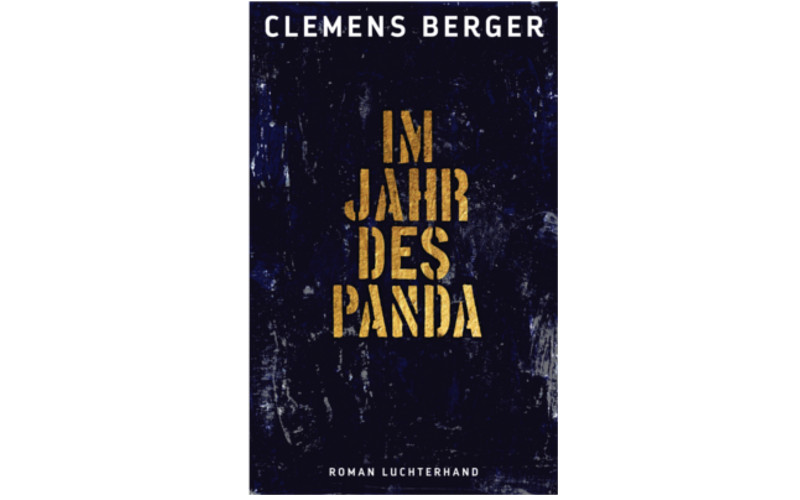
Der Panda sitzt als Chiffre des Glücks im Zentrum des bislang längsten Romans von Clemens Berger, Sinnbild einer neuen besseren Welt.
Dabei bürdet Berger dem in Schönbrunn geborenen Pandababy einiges auf. Es muss nicht nur die Besucherinnen entzücken, sondern seiner Pflegerin Rita eine Stimme verleihen und dabei noch die beiden großen Erzählstränge zusammenhalten, die sich in „Im Jahr des Panda“ abwechseln. Einer erzählt vom Leben des schwer reichen Künstlers Kasimir Ab, von dessen Krisen, Exzessen und Erlebnissen. Der andere von Pia und ihrem Freund Julian, die als BankomatbefüllerInnen in die Lage kommen, sich mit einer halben Million Euro abzusetzen. Als geübter Erzähler versteht Berger, Situationen, Orte und Charaktere farbenreich in einer klaren, wortreichen Prosa unterhaltsam zu beschreiben. Auch wenn man ihm das ein oder andere Klischee nachsehen muss, kommt Langeweile nur in den Passagen auf, in denen der zuweilen allzu redselige Panda uns mit seinem Alltag quält.
Clemens Berger der Spieler Schon der Roman „Das Streichelinstitut“, der Berger zurecht breitere Aufmerksamkeit verschaffte, spielte mit dem Verhältnis der Erzählhandlung zur Wirklichkeit des Autors. Im Streichelinstitut entscheidet ein junger Mann, der wie Berger selbst Philosophie studiert hat, sich unternehmerisch als Streichler zu versuchen. In „Im Jahr des Panda“ erhält er als „Streichelmonster“, das sich inzwischen als Schriftsteller versucht, mehrere Gastauftritte. Wie der Streichler versucht Berger mit seinen Büchern marktgemäß zu bleiben, reflektiert aber die Folgen, die diese Anpassung bei ihm auslöst, in seinen Romanen.
Nicht zufällig verwandeln sich alle seine Figuren zu Künstlerinnen, wenn sie es nicht, wie Kasimir, ohnehin schon sind. Ein Maler, dessen Spezialität es ist, Hände zu malen. Rita, die Pandapflegerin beginnt, mit Pandas Stimme ein Tagebuch zu verfassen und mutiert zur Schriftstellerin. Pia beschreibt auf der Flucht die Welt mit Kalendersprüchen benjaminisch aus der Perspektive ihrer Erlösung.
„Die Ampel war auf rot“ Spielerisch geht Berger auch mit der Theorie um, die sich meistens in dezenten Anspielungen versteckt, auf Walter Benjamin, auf Sigmund Freud, auf Theodor W. Adorno und Karl Marx. Manchmal verweist er so fein, dass man nicht sicher ist, ob man sich den Bezug nur einbildet. Etwa wenn er Pia denken lässt: „Natürlich, Liebe. Was sonst?“ und für Georg Kreisler geschädigte die Melodie von „Wenn nicht Liebe, was sonst“ anklingt. Direkte Zitate gibt es nie, einmal erinnert sich Kasimir nicht an Walter Benjamin, der in der Einbahnstraße das Werk als Totenmaske der Konzeption beschreibt.
Diese Anspielungen freuen natürlich jene, die sie entdecken. Der Autor zwinkert der Leserin zu und sie versteht. Das erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit. Man ist sich ähnlich. Vielleicht besser als jene, an denen diese Spielereien unbemerkt vorbeigehen oder nur den vagen Eindruck von Hintergründigkeit spürbar machen. Jedenfalls ist man mit ihm verbündet, denn Berger ist schließlich ein Linker.
Trojanischer Panda. Zu seinem Glück, lässt er das nicht immer heraushängen. Zuweilen ist „Im Jahr des Panda“ ein trojanisches Pferd. Der Roman kommt leicht und niedlich daher. Es geht schließlich um Pandas, wer liebt sie nicht? Aber es ist kein Roman über Pandas, sondern über den Kapitalismus und über das Geld. Nicht die flüchtigen Berührungspunkte zwischen den Künstlerproblemen Kasimir Abs und Pias und Julians Raub verbinden die beiden Geschichten, sondern sie beziehen sich indirekt aufeinander. Kasimir kauft sein eigenes Bild um dreihunderttausend Euro zurück, um es für sechshundert an einen zu verkaufen, der es wirklich mag. Sein Verhalten rückt den Raub einer schlappen halbe Mille in Proportion. „Kleine Fische“ sind Pia und Julian, das geht ihnen schließlich auf. So wie ihnen an manchen Stellen fast die Trostlosigkeit ihres neuen von Arbeit unbeschwerten Lebens dämmert. Es gibt keine Freiheit, ohne der Freiheit aller.
Zahme Verbrecher. Leider sind diese Realisationen selten und es überwiegt ein grundloser Optimismus für den der geschwätzige Panda wirklich ein geeignetes Sinnbild gibt. Überhaupt hält sich Berger in seinem neuen Buch an das adornosche Motto, das er dem Streichelinstitut vorangestellt hat, die Menschen seien immer noch besser als ihre Kultur. Diese Menschenfreundlichkeit ist ihm kaum vorzuwerfen, aber nach ein paar hundert Seiten Nerven diese VerbrecherInnen, die nichts Falsches tun. Pia und Julian rauben eine Bank aus, sie nehmen nur das tote Geld, das in den Bankomaten liegt und die Bank sei ohnedies versichert. Kasimir Ab bringt es zu einer Entführung, aber er entführt nur sich selbst, was ihn dennoch so erschreckt, das er über Nacht ergraut. Und immer wieder brabbelt der Panda.
Dann, dann, dann. Gegen versöhnliche Enden ist einiges zu sagen, aber in diesem Falle muss eines her. Denn man muss Clemens Berger lesen. Wenn nicht den Panda-Roman, dann „Die Wettesser“ oder „Das Streichelinstitut“. Es gibt keinen, der Linke beschreiben kann wie er. Mit entlarvender Genauigkeit, mit Humor und ohne einer Figur unrecht zu tun, denn er liebt sie alle. „Im Jahr des Panda“ ist ein Roman über die Möglichkeit eines besseren Lebens, eine Fantasie einer besseren Welt. Er ist sicher auch der Versuch, mit Farbe einen Abdruck an der Höhlenwand zu hinterlassen, die eigene Hand fragend in die Zukunft zu strecken. Er stellt Fragen nach dem Sinn von Kunst und Literatur. In einer Szene kommt Kasimir Ab ob seines immensen Erfolgs zu dem Schluss, es habe immer noch ein Wenn gegeben. „All diese Wenns hatten immer ein Dann versprochen: Dann wäre er ruhig, dann wäre er glücklich, dann könnte er durchatmen, dann wäre er der, der er immer hatte sein wollen, dann wäre alles gut.
Dann, dann, dann.“
Clemens Berger, Im Jahr des Panda. Luchterhand, 2016.







