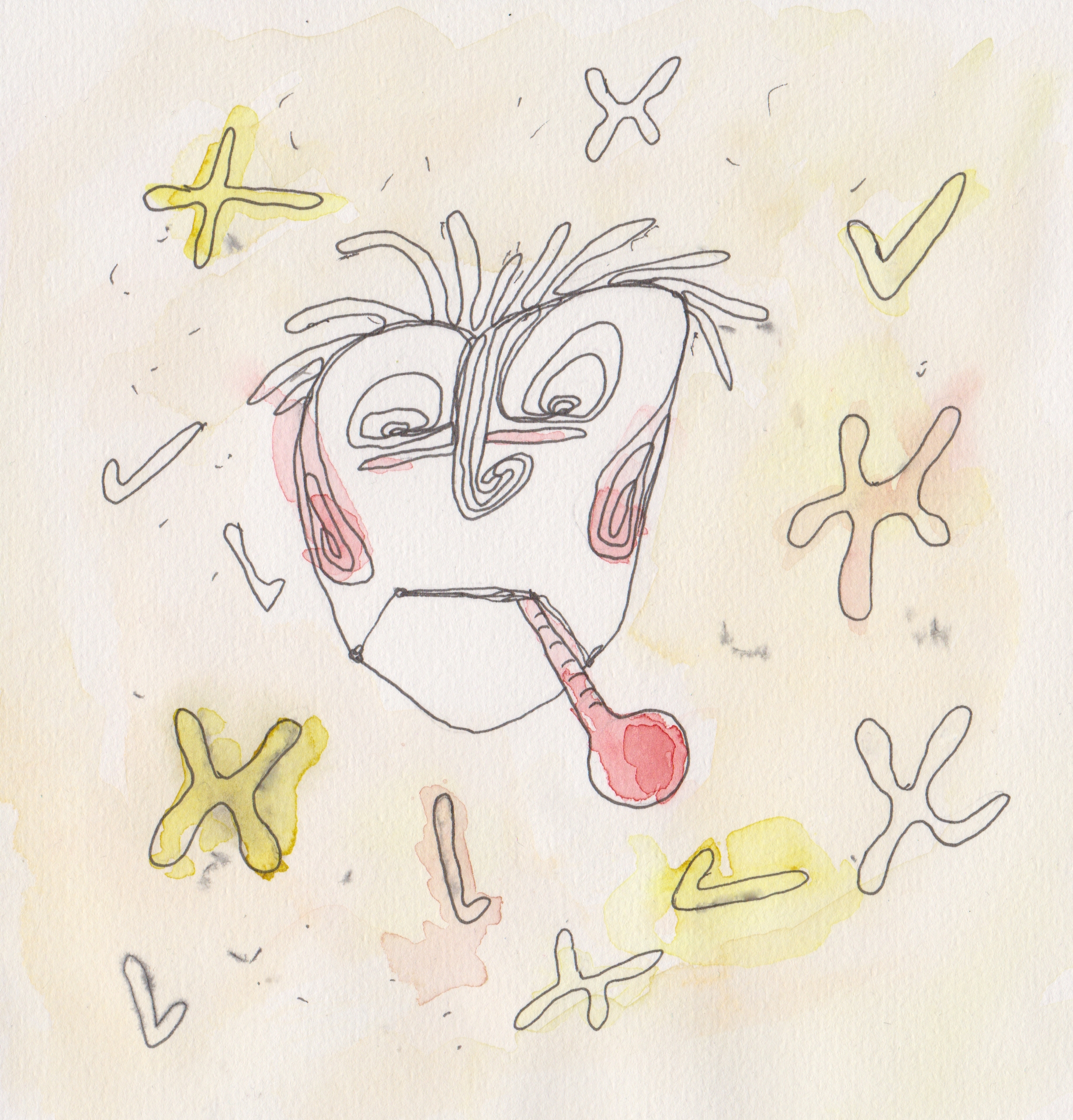K.O. im ersten Semester

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es sie gibt. Sie sind gefürchtet und provozieren etliche schlaflose Nächte. Und dennoch scheint es nicht so, als gäbe es wirklich ein Mittel dagegen. Die Rede ist von sogenannten „Knock Out-Prüfungen“, kurz KO-Prüfungen. Damit sind Prüfungen gemeint, die so schwer sind, dass nur sehr wenige Studierende sie beim ersten Versuch schaffen. Etwa, weil der zu lernende Stoffumfang enorm hoch ist oder die Prüfungsmodalitäten so unfair, dass es reine Glückssache ist, die Tests zu bestehen.
ILLEGALE ZUGANGSBESCHRÄNKUNG
Endes des letzten Semesters, im Juni 2017, waren KO-Prüfungen kurz in aller Munde, da ein besonders eklatanter Fall an der TU Wien medial bekannt geworden war. Die Lehrveranstaltungen „Mechanik 1“ und „Mechanik 2“ hatten desaströse Durchfallquoten von über 90 Prozent, in einer Prüfung fielen sogar 97 Prozent der Studierenden durch. Die Prüfungen betrafen zwei Maschinenbau-Bachelorstudien. In diesen Studien schlossen laut der Hochschüler_innenschaft der TU Wien (HTU Wien) weniger als drei Prozent der Studierenden ihr Studium innerhalb von acht Semestern ab, was der Regelstudienzeit plus zwei Toleranzsemester entspricht. Für die betroffenen Studierenden bedeuten diese Verzögerungen nicht nur ein verlängertes Studium im Lebenslauf, sondern oft auch den Wegfall von finanziellen Beihilfen wie der Studienbeihilfe. Neben der Durchfallrate wurden im Juni auch die Art und Weise der Wissensvermittlung, die langen Korrekturzeiten, aber auch die Bedingungen bei der Prüfungseinsicht moniert: „Bei der Einsicht für die Tests wartet man teilweise bis zu drei Stunden, um dann eine schnippische Antwort auf eine inhaltliche Frage zu bekommen oder vor den Mitstudierenden angebrüllt zu werden“, sagte Andreas Potucek, damals im Vorsitzteam der HTU Wien.
In vielen Studien ist es möglich, schwierige oder berühmt-berüchtigte Fächer bis zum Ende des Studiums hinauszuschieben. Das heißt einerseits, dass möglicherweise genügend Zeit zum Lernen da ist, andererseits kann sich durch diese Taktik das Studium empfindlich verlängern – besonders dann, wenn die nicht die drei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungstermine im Semester angeboten werden oder diese oft überfüllt sind. Ganz andere Hürden stellen KO-Prüfungen am Anfang eines Studiums dar, insbesondere dann, wenn sie Teil einer Prüfungskette sind (das Bestehen der Prüfung ist Voraussetzung für eine andere Lehrveranstaltung) oder gar zur Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) gehören. Bei der Einführung der StEOP wurde – vor allem seitens der ÖH – befürchtet, dass die verpflichtenden ersten Prüfungen dazu genützt würden, Studierende „rauszuprüfen“ und so unsichtbare Zugangsbeschränkungen aufzubauen. Das Universitätsgesetz ist in diesem Punkt allerdings klar, die StEOP darf explizit „nicht als quantitative Zugangsbeschränkung“ eingesetzt werden.
DER ROSENTHAL-EFFEKT
Christian, der sich an der Universität Wien in der Studienvertretung der Bildungswissenschaften engagiert, erzählt von KO-Prüfungen in seinem Bachelor: „Die StEOP ist ganz klar eine KO-Prüfung, außerdem die Methodenprüfungen. Davon gibt es sechs Stück, die alle nur ein einziges Mal im Jahr angeboten werden. Die meisten Studierenden schaffen sie irgendwann innerhalb der drei Jahre, die sie dafür Zeit haben“. Wenn die Studienvertretung nach mehr Kursen fragte, wird von der Studienprogrammleitung mit der Antwort abgespeist, das sei finanziell nicht möglich. Ist es die Unterfinanzierung der Hochschulen, die KO-Prüfungen zum notwendigen Übel macht – Notwehr sozusagen? Durch „geschickte“ Studienplangestaltung – in dem besonders lernaufwändige Fächer in die ersten Semester geschoben werden – lässt sich der finanzielle Aufwand, z.B. bei teuren Laborübungen für die folgenden Semestern verringern.
In der Praxis ist es schwer, nachzuweisen, dass Prüfungen in der StEOP als illegale Zugangsbeschränkungen genutzt werden – immerhin lässt sich aus Position der Lehrenden leicht mit angeblichen „sinkenden Niveau“ der Studienanfänger_innen argumentieren. Solche Klagen sind allerdings nicht unbedingt neu. Bereits im Jahr 1788, als in Deutschland das Abitur (das Äquivalent zur Matura) eingeführt wurde, klagte der Kanzler der Universität Halle darüber, die Studierenden seien „alle so dumm“ und würden sich aus den falschen Kreisen rekrutieren. Wenn sich diese Mythen der Erstsemestrigen, die angeblich immer dümmer werden, sich unter Lehrenden halten, kann dies jedoch auch wie eine selbsterfüllende Prophezeiung einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Der sogenannte Rosenthal-Effekt beschreibt, dass Schüler_innen, von denen Lehrende glauben, dass sie besonders klug oder dumm seien, entsprechende Ergebnisse liefern. Mitte der 1960er Jahre führte der US-Psychologe Robert Rosenthal Experimente mit Schulkindern durch, die diesen Effekt zeigten. Die Ergebnisse von KO-Prüfungen könnten also viel mehr an den Lehrenden liegen, als diese vielleicht glauben.
SAUSCHWERE PRÜFUNGEN
An der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) wird offen von Zugangsbeschränkungen durch KO-Prüfungen geredet. Laut der ÖH WU hört fast die Hälfte der Studienanfänger_innen schon nach dem ersten Semester an der WU wieder auf. Besonders gefürchtet ist die StEOP-Lehrveranstaltung „Einführung in die Rechtswissenschaften“, bei der fast 80 Prozent der Studierenden durchfallen. Patricio, ein ehemaliger WU-Student, berichtet: „Ich hatte mal in einem MC-Test einen Fall, wo einfach der Beistrich fehlte und der Aussage dann eine neue Bedeutung zukam.“ Solche Spitzfindigkeiten, gepaart mit enormen Zeitdruck und wenigen Prüfungsplätzen sorgen dafür, dass Prüfungen kaum zu bewältigen sind. Die Vermutung, dass durch solche Prüfungsmethoden gezielt dafür gesorgt werden soll, die Zahl der Studierenden zu verringern, liegt nahe. Manchmal ist es jedoch auch der Stoffumfang, der dafür sorgt, dass Prüfungen kaum zu bewältigen sind. Milena, die ihr Architekturstudium an der TU-Wien abgebrochen hat, erzählt von der Lehrveranstaltung „Einführung Hochbau“: „Für die Prüfung muss man mindestens einen Monat lernen. Und wenn ich einen Monat sage, meine ich reines Lernen, ohne Projekte oder Arbeiten nebenbei. Nach meinen Erfahrungen fällt ungefähr die Hälfte durch, die meisten Studierenden brauchen zwei bei drei Anläufe, bis sie die Prüfung schaffen.“
In manchen Fällen sind es die Unterlagen, die eine Hürde darstellen. Im Bachelor „Umwelt- und Bioressourcenmanagement“ an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) klagen viele Studierende über die Prüfungen der beiden „Standortkunde“-Fächer, die verpflichtend im Studienplan stehen. „Bei aller Freundlichkeit und Sachlichkeit, der Professor hat die Berufung verfehlt. Unfreundlich, kompromissresistent und stets sauschwere Prüfungen, die einen in den Wahnsinn treiben“, beschreibt ein Studierender, der lieber anonym bleiben möchte, das Fach. Eine seiner Kolleginnen findet die Unterlagen – es handelt sich vor allem um Powerpoint-Folien – zu dürftig, um die Prüfungsfragen richtig beantworten zu können. Die Statistik der BOKU zeigt: Rund ein Drittel der Studierenden schafft die Prüfung nicht, eben so viele schaffen knapp einen Vierer.
STRESS UND DRUCK
Schwierige Prüfungen sind der meistgenannte Grund für Verzögerungen im Studium bei Studienanfänger_innen, überdurchschnittlich oft wird er in den Rechtswissenschaften, im Lehramt, in Ingenieurs- und Naturwissenschaften genannt, wie die Studierenden-Sozialerhebung 2015 zu berichten weiß. Auch hier berichten viele Studierende von KO-Prüfungen und erwähnen im gleichen Atemzug den hohen Stresspegel, der mit dem Leistungsdruck einher geht. Zu wie vielen Abbrüchen KO-Prüfungen führen, ist leider nicht untersucht worden.
Es lässt sich sicher vorzüglich über die Frage streiten, ob KO-Prüfungen vermieden werden könnten, wenn sie durch Zugangsbeschränkungen ersetzt würden – dadurch würde der Zugang zum Studium jedoch auf keinen Fall fairer. Zugangsbeschränkungen führen nämlich dazu, dass die Zahl von Studierenden aus Nicht-Akademiker_innenhaushalten sinkt, wie eine Studie der Arbeiterkammer festgestellt hat. Solange die Universitäten nicht ausreichend Mittel erhalten, um ihre Studierenden sinnvoll zu betreuen, wird es KO-Prüfungen geben. Einerseits, weil die Universitäten so versuchen, die Zahl der Studierenden zu minimieren und andererseits, weil kein Geld und keine Anreize für didaktische sinnvolle Lehre da ist. Mit guter Betreuung, die Studierende ernst nimmt und angemessenen didaktischen Methoden wäre es kein Ding der Unmöglichkeit, schwierige Fächer so zu vermitteln, dass die Durchfallquoten gering blieben. Bis dahin bleibt Studierenden meist nur eins: Zeit investieren, Büffeln und auf „Vier gewinnt“ hoffen.
Joël Adami studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien