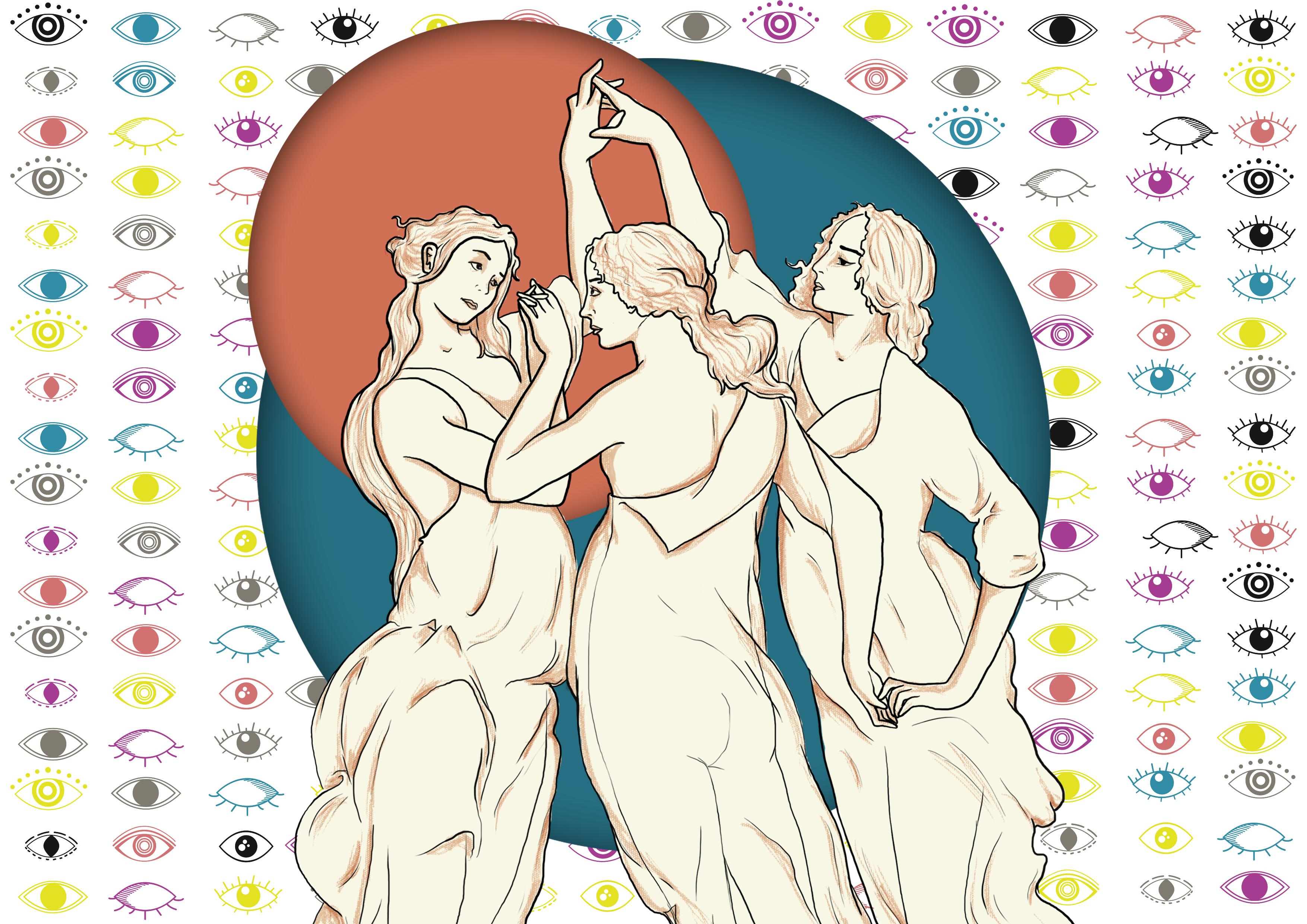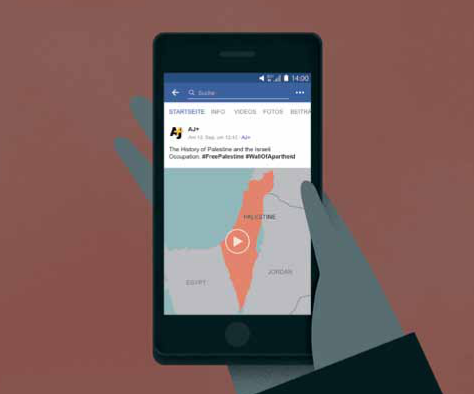Karrieresprungbrett ÖH

Die ÖH bietet das einzigartige Erlebnis, in einer Koalition mit höchst unterschiedlichen Leuten zu arbeiten: ein kurzer Einblick in eine Institution mit Karrierist*innen, Nachwuchspolitiker*innen und engagierten Studierenden.
Räumen wir gleich zu Beginn mit einem Vorurteil auf, welches der ÖH-Arbeit oft unterstellt wird: Es ist Arbeit! Und zwar viel Arbeit, undankbare Arbeit und unterbezahlte Arbeit. In meiner langen ÖH-Karriere durfte ich vor allem großartige ÖH-Frauen kennen lernen, die für eine Aufwandsentschädigung von 360 Euro 30 bis 40 Stunden die Woche gearbeitet haben. Viele stellten ihr Studium und ihr Sozialleben hinten an, um sich für bessere Studienbedingungen für alle Studierenden einzusetzen. Die Studierenden danken es oft mit Ignoranz, Abneigung oder gar off ener Feindschaft. Von der Opposition bekommt man noch ständig an den Latz geknallt, dass man sich nur um die „Weltrevolution“ kümmere und nicht um studienrelevante Themen und Service. Nur wird verkannt, dass die meisten Studienvertretungen eben beides machen.
Und dabei zerreiben sie sich zwischen dem Anspruch, bessere Bedingungen an Hochschulen zu schaff en, und der Realität, ein System mitzutragen, das in den letzten Jahren immer mehr Verschlechterungen in diesem Bereich brachte, gerade für nicht privilegierte Studierende.
REALISMUS UND SEILSCHAFT. Dass man nach Jahren zermürbender ÖH-Arbeit dann auch einen Nutzen ziehen oder wenigstens keinen Nachteil daraus haben möchte, ist verständlich. So sagte mir eine ÖH-Kollegin vor einiger Zeit, als eine sehr gut bezahlte Stelle in einer parteinahen Organisation ausgeschrieben wurde: „Jetzt habe ich mir jahrelang den Arsch aufgerissen für die Fraktion und die Partei, jetzt will ich dann auch einen Posten von denen haben.“ Diese Erwartungshaltung wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas präpotent, doch sie ist realistisch. Bei einer Stelle in der Partei oder deren Vorfeldorganisationen spielt die Mitgliedschaft und die Linientreue mindestens eine genauso große Rolle wie die Qualifikation.
Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass nicht wenige Parteigranden ihre politische Karriere in der ÖH begannen. Schaut man sich die Liste der ehemaligen ÖH-Vorsitzenden (und damit den prestigeträchtigsten Posten innerhalb der ÖH) an, dann finden sich die Namen einiger prominenter Politiker*innen: Sigrid Maurer, der während ihrer Zeit als ÖH-Vorsitzende der GRAS noch Hausverbot im Parlament wegen Störung erteilt wurde, sitzt jetzt eben dort. Wer in der SPÖ Karriere machen will, sollte sich ein Beispiel an Heinz Fischer (Vorsitzender der Bundesvertretung) und Michael Häupl (VSStÖ-Vorsitzender) nehmen und die politische Karriere bereits im Studium in Angriff nehmen. Im Übrigen war es Michael Häupl als VSStÖ-Vorsitzender, der Peter Pilz aus dem VSStÖ ausschloss. Das hat dessen Karriere nach einem Parteiwechsel wohl nicht geschadet. Auch bei den Konservativen ist ÖH-Arbeit gern gesehen – Reinhold Lopatka war Studienvertreter der Jurist*innen in Graz – allerdings ist die Mitgliedschaft im erzkonservativen Cartellverband wohl noch karrierefördender.
Die ÖH-Politik ist hier sowohl Ochsentour als auch Politkindergarten, wo Nachwuchspolitiker*innen schon mal Erfahrungen am parteipolitischen Parkett sammeln können. Gleichzeitig gibt es Vorgaben der Partei, die auch hier umgesetzt werden müssen. Kostspieligen Projekten oder Rücklagenauflösungen steht man zögerlich gegenüber, will man sich doch nicht mit einem zweiten „Café Rosa“ die politische Karriere verbauen.
Wer sich also in der ÖH abgearbeitet hat, kann bei manchen Fraktionen zurecht auf einen der hochdotierten Parteijobs hoffen. ÖH-Arbeit wird aber nicht nur in der Bewerbung zur/m Parlamentsmitarbeiter*in gerne gesehen, sondern auch in staatsnahen Betrieben helfen ÖH-Erfahrung und das richtige Parteibuch. Bundeskanzler Christian Kern kann ein Lied davon singen, sein Weg führte über den VSStÖ zu den ÖBB.
Wenn die „parteiunabhängige“ ÖH-Fraktion keinen Posten abwirft, dann kann man immer noch seine politische Meinung mir nichts dir nichts wechseln, so geschehen bei Kilian Stark, der noch 2013 für die FLÖ in der Bundesvertretung arbeitete und 2014 schon für die Grünen Penzing tätig war.
REBELLION UND QUALIFIKATION. Gerne wird die Studienzeit dann rückwirkend als rebellische Phase imaginiert, in der man noch aufmüpfi g und idealistisch war. Doch selbst diesen Anspruch haben einige in der ÖH wohl nicht an sich selbst. Denn nicht nur die Parteien wissen von der nützlichen Erfahrung, die man in der ÖH sammeln kann. Wer in der ÖH tätig war, weiß, wie man Veranstaltungen organisiert, Texte schreibt und redigiert, Verhandlungen führt und im Team zusammenarbeitet. Das sind alles Skills, die auch auf dem freien Markt gerne gesehen sind – und deshalb ist die ÖH im Lebenslauf ein großes Plus. Gerade im Öffentlichkeitsreferat lernt man all die nützlichen Tools, die man später in jeder PR-Firma und Werbeagentur einsetzen kann. Und inzwischen wissen auch Studierende, dass es kaum ein Manko ist, ein wenig länger fürs Studium zu brauchen, aber durch die ÖH schon Berufserfahrung auf dem Buckel zu haben.
Bei all dem darf nicht vergessen werden, dass die ÖH-Arbeit nicht allen offensteht. Natürlich gibt es redliche Bemühungen, gerade von Basisgruppen, so inklusiv und off en wie möglich zu sein. Doch nicht alle Studierenden haben die Zeit und die Ressourcen, sich der ÖH-Arbeit zu widmen. Hat man zum Beispiel Betreuungspflichten, wird die Teilnahme an abendlichen Plena, die sich bis in die Nacht ziehen, nahezu unmöglich. Auch sind nicht alle Studierenden entsprechend gut vernetzt, um einen Posten in Hochschul- oder gar Bundesvertretung zu ergattern. Auch wenn ÖH-Arbeit aufwendig und wichtig ist und Respekt verdient, so ist sie gleichzeitig ein Privileg.
Anne Marie Faisst studiert Internationale Entwicklung in Wien und ist seit Jahren politisch in der ÖH aktiv.
Anmerkung der Redaktion: In der Print-Version dieses Artikels stand fälschlicherweise, der Grüne Nationalratsabgeordnete Julian Schmid sei bei der GRAS gewesen. Es handelte sich um eine Verwechslung. Wir bitten dies zu entschuldigen.