Aus mitgemeint wird nicht gemeint
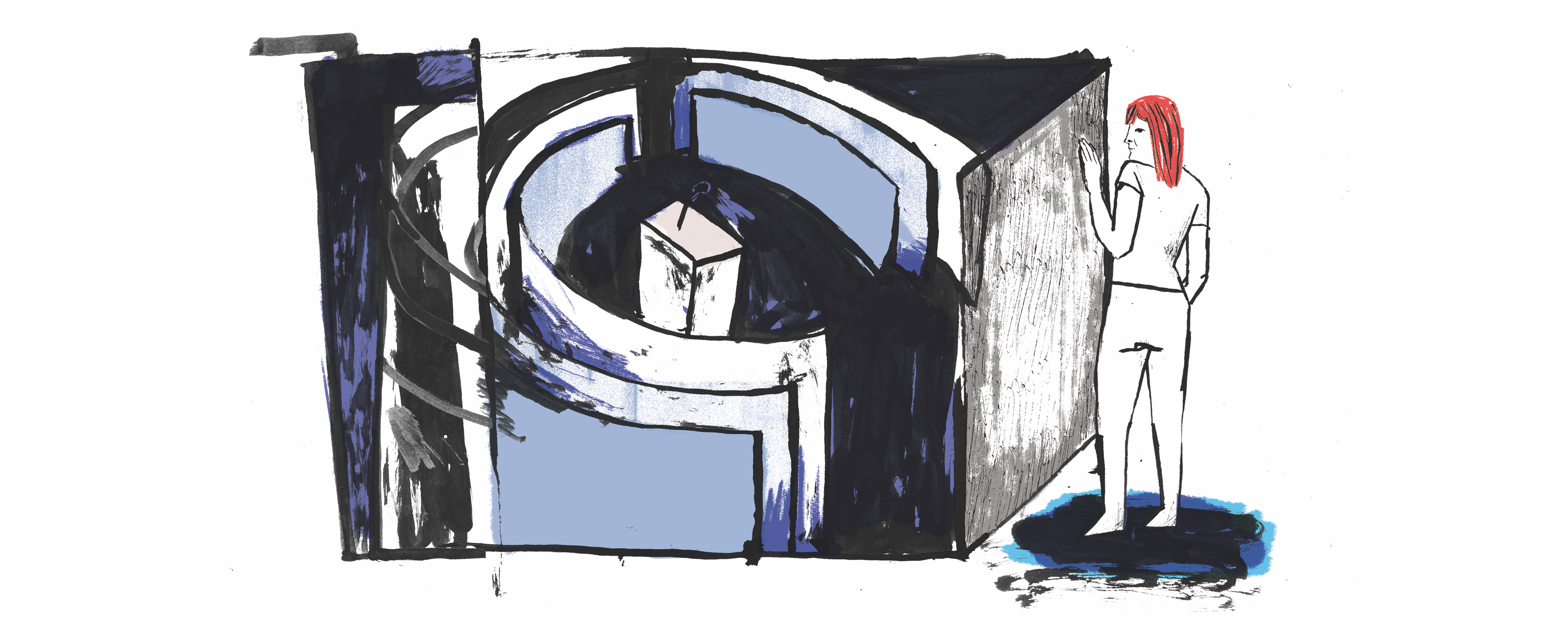
Europa war, entgegen des Eindrucks, den die pro-europäische Euphorie gerne hinterlässt, nie eine Insel der Seligen. Zumindest nicht für alle. Mittlerweile bröckelt auch das innereuropäische Image. Einerseits wird die restriktive Grenzpolitik der Europäischen Union als „Festung Europa“ kritisiert, andererseits werden ihre Institutionen von jenen, die diese Festung seit Jahren mit aufbauen, als Kontrollinstanzen infrage gestellt. Vor allem von rechtsextremen Kräften, die allmählich mehr als nur bedrohliche Tendenzen in der Ferne darstellen und sich schon viel weiter als bloß „auf dem Vormarsch“ befinden. Ihr Zuspruch nimmt kontinuierlich zu, ihre Anhänger_innenschaft wächst, wird selbstbewusster und lauter. Ihre Themensetzung überlagert die ihrer Gegner_innen um ein Vielfaches. Auch, weil diese aus der Not heraus immer nur damit beschäftigt sind, dagegen zu reden, anstatt eigene Schwerpunkte zu setzen, die am Ende ohnehin kaum jemand außerhalb der eigenen Bubble mitbekommt. Dafür sind nicht zuletzt Medien mitverantwortlich, denn auch sie scheinen vorrangig an den Aussagen rechter Regierungs- und Parteispitzen interessiert zu sein. Auch sie wollen sensationalistische Bedürfnisse befriedigen und Inhalte verkaufen. Es ist eine konsequente Maschinerie, von der Politiker_innen aus dem rechten Spektrum profitieren. Sie hat sich in den letzten Jahren ohne viel Aufwand verselb- ständigt und wird durch die „moderate“ Mitte und neoliberale Verbündete noch gestärkt. Dabei bleiben essentielle Belange auf der Strecke oder werden ins- trumentalisiert. So etwa auch die Gleichstellung der Geschlechter. Hat das Thema keinen Platz mehr?
Selbstgefälligkeit und Backlash.
Grundsätzlich ist es selbst für politisch interessierte Zuschauer_innen nicht einfach, die Geschehnisse im Europäischen Parlament mitzuverfolgen. Das zeichnet sich auch an der sinkenden Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen ab. 2014 lag sie bei schlanken 42,61 Prozent, 1994 noch bei 56,67 Prozent und 1979 sogar bei 61,99 Prozent. Wie hoch sie bei den dies- jährigen EU-Parlamentswahlen Ende Mai ausfallen wird, wird sich zeigen. Juliette Sanchez-Lambert, Generalsekretärin der LGBTI-Intergroup im EU-Par- lament und feministische Aktivistin, bedauert, dass sich Menschen in vielen Mitgliedstaaten so losgelöst fühlen von der EU. „Sie werden schon länger nicht schlau aus diesem riesigen Apparat“, sagt sie.
Für Sanchez-Lambert ergibt sich daraus ein weiteres Problem. Je weniger Wähler_innen es gibt, desto weniger Interessierte gibt es auch für Themen, die sich nicht (nur) um Migration drehen. Frauen- und LGBTI-Rechte etwa. Sie spricht von einer starken Polarisierung, was diese Belange angeht, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf jener der einzelnen Staaten. „Während in den Niederlanden, Finnland und Schweden oft eine Selbstgefälligkeit vorherrscht, weil schon so viel passiert ist, gibt es in Ländern wie Polen, Rumänien und Italien einen starken, organisierten Backlash, der nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch auf Regierungsebene sichtbar ist“, sagt sie. Der Backlash der einzelnen Staaten sei wiederum auf der Ebene der EU-Institutionen spürbar. „Es gab insbesondere bei der Arbeit der Kommission große Fortschritte in den Bereichen Gender Mainstreaming und LGBTI- und Minderheiten-Rechte. Mittlerweile ändert sich das wieder. Die Balance, die wir schon hatten, beginnt zu erodieren“, sagt Sanchez-Lambert und appelliert an die Solidarität progressiver Gruppen untereinander.
„Gibt's nicht's Wichtigeres?“
Eine Beobachtung, die sie macht, wenn Personen, Gruppen oder Parteien sich eines anderen Themas als Flucht und Migration annehmen, etwas anderes als wichtiger oder zumindest ebenso wichtig deklarieren, ist der Vorwurf, dass wir doch größere Probleme hätten. Gerade, wenn es um Forderungen und Errungenschaften im Bereich der Frauen- und Minderheitenrechte geht, scheint das ein beliebtes Totschlagargument zu sein. So blieb ihr ein Kommentar auf Twitter in Erinnerung, als die Co-Vorsitzende der LGBTI-Intergroup und Abgeordnete für die Europäischen Grünen Terry Reintke kürzlich verlautbarte, dass das Parlament die erste EU-Resolution zur Stärkung der Rechte intergeschlechtlicher Men- schen beschlossen hatte. Jemand kommentierte den historischen Beschluss, dass unfreiwillige medizinische Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern von nun an EU-weit nicht mehr stattfinden dürfen, damit, dass es doch wichtigere Themen gäbe, um die man sich kümmern könnte. Sanchez-Lambert nennt den Kommentar symptomatisch. „Das ist eine Form von Silencing. Damit soll sichergestellt werden, dass die Themen nicht zu viel Platz einnehmen. Den Betroffenen wird gesagt, dass sie besser in ihren unterdrückten Positionen bleiben“, sagt sie. „Diese Menschen sagen natürlich auch, dass Menschenrechte universell sind, aber das sind sie nicht“, so Sanchez-Lambert weiter. Frauen und Minderheiten würden auch auf struktureller Ebene gegeneinander ausgespielt. Einerseits durch begrenzte Aufmerksamkeit für Menschenrechtsthe- men im öffentlichen Diskurs und andererseits durch die Kürzung von Förderungen. „Um öffentlichkeitswirksam arbeiten zu können, braucht man Geld und das ist immer schwerer zu bekommen“, sagt sie.
Feministische Errungenschaften sind alles andere als stabil.
Doch nicht nur auf EU-Ebene ist es mit großen Anstrengungen verbun- den, Frauen- und Minderheitenrechte zu thematisie- ren und voranzutreiben. In den EU-Mitgliedstaaten verschieben sich Werte nach rechts. Rechts bedeutet immer zuerst die Infragestellung der Selbstbestim- mungsrechte von Frauen und jenen, die sich nicht in das binäre und heteronormative Gesellschaftssystem einordnen wollen. So erfreulich die Resolution für intergeschlechtliche Personen ist, so notwendig war sie in dieser regressiv geprägten Zeit.
Es gibt viele Bereiche, anhand derer man sich aktuelle reaktionäre Bestrebungen ansehen kann. Repräsentation in politischen Entscheidungspositi- onen, wobei das nicht automatisch ein Merkmal für Progressivität sein muss. Eine Abgeordnete in einer rechtsextremen oder konservativen Fraktion wird keine ernsthaften feministischen Ambitionen haben. Außerdem erstarken reaktionäre Stimmen in den Themenbereichen Gleichstellung am Arbeitsplatz, Kinderbetreuung, Selbstbestimmung sowie reproduktive Rechte und Schutz gewaltbetroffener Frauen und LGBTI-Personen.
Im Europäischen Parlament sind nur 37 Prozent der Abgeordneten Frauen. Die höchsten Frauenanteile haben die Abgeordneten aus Malta, Schweden, Finn- land, Irland und Estland. In nationalen Parlamenten liegt Schweden mit 46,1 Prozent vorne. Österreich liegt mit 37 Prozent im europäischen Durchschnitt. Doch wie gesagt, Repräsentation muss kein Indikator für feministische Politik sein, wenn die übrigen Ungleichheiten nicht ebenso beharrlich verfolgt werden oder andere Errungenschaften sogar wieder rückgängig gemacht werden. Gut zu beobachten ist das am Umgang der Staaten mit dem Schwangerschaftsabbruch. Belgien markiert mit der Entscheidung, ihn aus dem Strafgesetz zu streichen, eine Ausnahme in der patriarchal dominierten Diskussion um reproduktive Rechte. Ebenso Irland, das 2018 gegen das bis dahin vorherrschende rigide Verbot gestimmt hat. Während in den letzten Jahren Polen der zentrale Austragungsort des Kampfes um Selbstbestimmung in Europa war, ist es nun Deutschland aufgrund der Proteste gegen das Informationsverbot für Ärzt_innen. In Österreich fiel der mögliche Startschuss für das Ringen um die Fristenlösung mit einer Petition, die unter dem Deckmantel der Behindertenrechte Einschränkungen des straffreien Schwangerschaftsabbruchs fordert. In katholischen Ländern wie Italien wird es für Schwangere trotz legaler Möglichkeiten immer schwieriger, überhaupt Ärzt_innen zu finden, die Abtreibungen durchführen. Auch so lassen sich Selbstbestimmungsrechte einschränken.
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Das Thema Arbeit ist innerhalb der EU weniger ideologisch geprägt. Maria Y. Lee, Juristin und Rechtsphilosophin an der Universität Wien, betont, dass das Diskriminierungsverbot am Arbeitsplatz, wie wir es heute auch in Österreich kennen, der EU geschuldet ist. „Österreich hatte ein Gleichbehandlungsgesetz, aber es war noch lange nicht so weit wie jenes auf EU-Ebene. Es ging nicht nur um gleichen Lohn für Männer und Frauen, sondern auch um die sonstigen Arbeitsbedingungen. Mit dem EU-Beitritt wurde das Gesetz übernommen, weil das Bedingung ist“, sagt Lee. Und der Gender Pay Gap? „Es gibt EU-weite Studien, die besagen, dass sich zwischen 50 und 75 Prozent des Gender Pay Gaps nicht durch Wochenstunden, Branche und Kinderbetreuungszeiten erklären lassen. Was bleibt, ist Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“, sagt sie. Dabei spricht sie auch Frauen an, die Kopftuch tragen. Ein Diskriminierungspotential, das immer nur unter dem Merkmal Religion abgehandelt wird, obwohl es zu gleichen Teilen eine geschlechtliche Komponente hat. „Da wird Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unsichtbar gemacht“, sagt Lee.
Dass Kinder fast ausschließlich für Mütter Einschnitte in die berufliche Laufbahn bedeuten, zeigt immer wieder deutlich, dass unbezahlte Fürsorgearbeit in der Gesellschaft nach wie vor als Frauensache deklariert wird. Während es für Frauen den Mythos der „Wahlfreiheit“ gibt, steht diese für Männer gar nicht erst zur Debatte. Sie müssen sich nicht entscheiden und sie müssen Job und Familie nicht „unter einen Hut“ bringen. Während für Väter nach wie vor „Anreize“ geschaffen werden, um sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern, wird die bedingungslose Bereitschaft von Müttern einfach vorausgesetzt. Schweden ist beim Thema Kinderbetreuung im EU-Vergleich am progressivsten, nicht nur nehmen Väter vermehrt Karenzzeit in Anspruch, das Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen ist auch in ländlichen Gemeinden relativ dicht und Arbeitgeber_innen sind zunehmend auf Schiene. In Österreich arbeiten immer noch 67,3 Prozent der Mütter in Teilzeitjobs, während Väter indessen fast ausschließlich in Vollzeitjobs arbeiten.
„Diskriminierung ist nichts, was der Vergangenheit angehört. Wir haben viel erreicht, aber wir sind noch nicht so weit, zu sagen, dass Frausein nichts mehr bedeutet und wir deshalb kein Antidiskriminierungsgesetz mehr brauchen“, fasst Lee zusammen. Sanchez-Lambert setzt auf Konfrontation. „Menschen haben Angst vor dem Konzept von 'Gender', weil sie in sehr genderkonformen Gesellschaften geboren und aufgewachsen sind. Diese Ängste sollten angesprochen werden und zwar so, dass die Gesellschaft dadurch zum Positiven verändert werden kann." So lange bis Frauen- und LGBTI-Rechte nicht mehr nur als optional, sondern als verbindlich gelten.
Nicole Schöndorfer hat Publizistik, Anglistik und Journalismus an der Universität Wien und an der FH Wien studiert und lebt als freie Journalistin und Vortragende in Wien.


