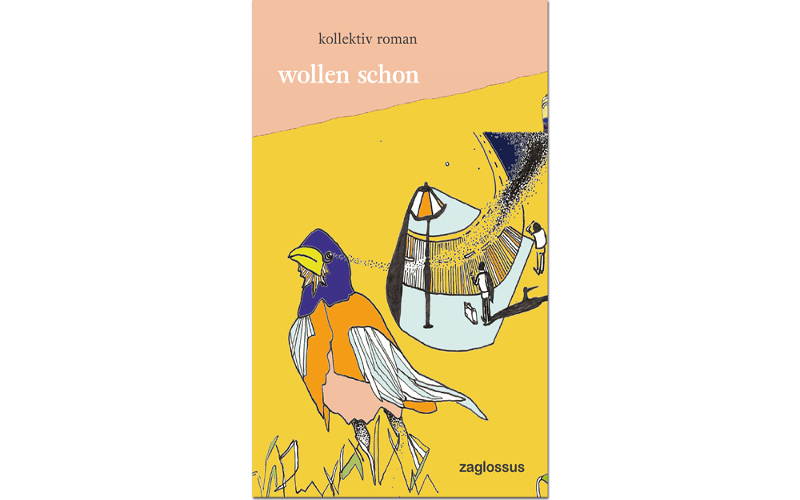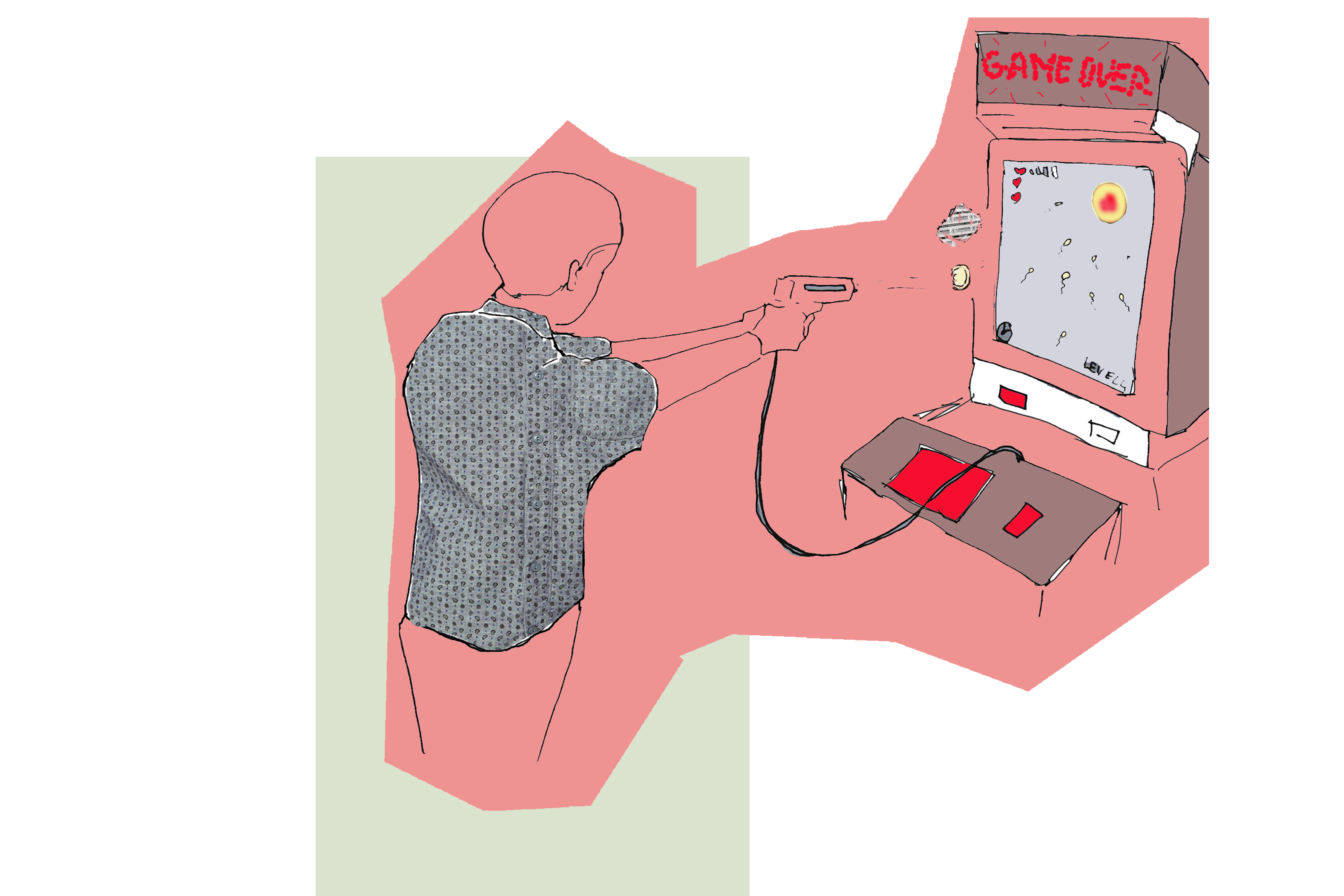Undurchschaubare Vergabe, Probleme bei der Anrechnung, gesunkene Mobilität und imaginäre Workloads – die Bologna-Reform hat versagt. Mitschuld sind die ECTS-Punkte.
„Wie viele ECTS hast du dieses Semester gemacht?“ Diese Frage ist zu einem fixen Bestandteil studentischen Smalltalks avanciert. Je nach Antwort kann ein wohliges Gefühl der Wärme und Selbstzufriedenheit oder aber abgrundtiefe Scham aufkommen. Das „European Credit Transfer and Accumulation System“, besser bekannt als ECTS, weist jedem Lernziel eine bestimmte Anzahl an Credits zu. Es soll sicherstellen, dass die Leistungen von Studierenden an Hochschulen des europäischen Hochschulraums vergleichbar sind.
Offiziell steht ein ECTS-Punkt – zumindest in Österreich – für etwa 25 Stunden Arbeit. Doch wie viele Stunden braucht es, um die einzigartige Ästhetik der Werke Frida Kahlos gebührend zu erfassen? Wann hat man die kritische Theorie und das Wirken der Frankfurter Schule tatsächlich begriffen? Und wie viel Zeit verstreicht, bis das physikalische Phänomen der Zeitdehnung wirklich durchschaut ist? Unmöglich, das allgemein zu definieren? Tja. Über solche Widersprüche setzt sich das ECTS-System hinweg: Wichtig ist es zu zählen, zu messen und zu vergleichen.
Etwa 9.000 Credits vor unserer Zeit, also im Europa des Jahres 1989, wurde die Einführung des ECTS
im Rahmen eines EU-Projektes erstmals erprobt. Die Semesterwochenstunden, die nur die Dauer der Lehrveranstaltung gemessen haben, waren damit Geschichte. ECTS-Punkte sollten von nun an – zumindest in der Theorie – den tatsächlichen Arbeitsaufwand der Studierenden messen. Nicht nur das Sitzen in der Vorlesung oder im Seminar ist also relevant, auch Selbststudium, die Vorbereitung von Referaten und das Büffeln für die Prüfung werden so angeblich eingerechnet.
NOTHING COMPARES TO YOU. In der Praxis bestimmen die Curricularkommissionen über die korrekte Anzahl der ECTS-Punkte – im Idealfall in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Lehrenden und den betroffenen Studierenden. Mathias, der lieber anonym bleiben möchte, ist Teil einer solchen Kommission und erzählt, dass es mit den Punkten oft nicht so genau genommen wird: „Als unser Studienplan überarbeitet wurde, wollten natürlich möglichst viele Institute in den Pflichtlehrveranstaltungen vertreten sein. Da geht es dann oft auch um finanzielle Überlegungen. Damit sich die eine Vorlesung für das eine Institut noch ausging, hat man bei der anderen Lehrveranstaltung halt noch einen ECTS-Punkt abgezwackt. Das Arbeitspensum für die Studierenden blieb aber bei der gekürzten Lehrveranstaltung im Endeffekt gleich. Dem Lehrenden war es wurscht. Der wollte einfach sein Programm durchziehen.“
Im Universitätsgesetz ist festgelegt, dass das Arbeitspensum eines Studienjahres 1.500 Stunden betragen muss. Umgerechnet sollen Studierende also etwa sechs Stunden pro Arbeitstag für das Studium aufwenden, um in Mindeststudiendauer abzuschließen – auch in der vorlesungsfreien Zeit. Diesem jährlichen Idealpensum, das für berufstätige Studierende ohnehin illusorisch ist, werden 60 ECTS-Punkte zugeteilt. Dass 25 Arbeitsstunden für einen Punkt aufgebracht werden müssen, ist aber nicht überall so. Obwohl das System der internationalen Vergleichbarkeit dienen soll, müssen Studierende für den Erwerb eines Leistungspunktes in den 49 Bologna-Staaten unterschiedlich viele Stunden aufwenden. In Deutschland sind es beispielsweise 30 Stunden, in Portugal oder Dänemark 28 Stunden, in Finnland 27 Stunden, in Estland 26 Stunden und in Österreich oder Spanien nur 25 Stunden. Für ein gleichwertiges Bachelorstudium mit 180 ECTS-Punkten müssen Studierende in Österreich also rein formell 900 Stunden weniger aufbringen als Studierende in Deutschland.

Doch selbst innerhalb Österreichs gibt es trotz formaler Gleichrangigkeit erhebliche Unterschiede in der durchschnittlichen Studiendauer. So brauchen Studierende der Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) durchschnittlich 8,3 Semester bis zum Bachelorabschluss, Studierende der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Klagenfurt durchschnittlich 6,1 Semester. Beide Studien werden mit 180 ECTS – also dem selben Zeitaufwand – bewertet. Ein solch eklatanter Unterschied dürfte in der streng genormten ECTS- Welt gar nicht auftreten. Tatsächlich bestehen jedoch zwischen den kalkulierten Zeiteinheiten und den real aufgewendeten Zeiten erhebliche Unterschiede.
Ein einigermaßen absurdes Beispiel liefert die interuniversitäre Wiener Ringvorlesung „Sustainability Challenge“ im aktuellen Sommersemester 2015. Während Studierende der Wirtschaftsuniversität, der Technischen Universität und BOKU nach erfolgreichem Bestehen vier ECTS-Punkte erhalten, dürfen sich Studierende der Universität Wien bei gleichen Anforderungen über zehn Punkte freuen. Der ungerechtfertigte Unterschied entspricht einem Zeitraum, in dem man sich zweimal hintereinander alle 208 Folgen „How I Met Your Mother“ oder dreizehnmal alle extended Versions der „Herr der Ringe“-Trilogie reinziehen kann.
Beispiele für eine nicht nachvollziehbare Zuteilung von ECTS-Punkten gibt es viele: So berichtet Andreas Thaler, dass er für eine Vorlesung mit drei Punkten insgesamt überhaupt nur eine Stunde aufgewendet habe. Janine, die ihren vollen Namen lieber nicht nennen möchte, beschwert sich, dass ihr für eine Übung mit verpflichtenden Präsenzterminen, Seminararbeit und Referat nur zwei ECTS-Punkte gutgeschrieben wurden. Beide studieren Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU. Selbst innerhalb der einzelnen Studienrichtungen ist es also mit der Vergleichbarkeit des tatsächlichen Workloads nicht weit her.
BOULEVARD OF BROKEN DREAMS. Brisant wird die durchwegs verschieden interpretierte Vergabe von ECTS-Punkten spätestens, wenn es um den Anspruch auf Familienbeihilfe, Studienbeihilfe und Mitversicherung geht. Denn dazu muss jeweils eine Mindestanzahl an Credits nachgewiesen werden. Für ausländische Studierende geht es beim semesterlichen Punktesammeln gar um die Aufenthaltsgenehmigung in Österreich. Soll diese verlängert werden, müssen 16 ECTS vorgelegt werden. Wird dieses Pensum nicht erreicht, droht die Abschiebung.
Auch Studierende, die ein Doppelstudium betreiben, müssen bei ihrer Semesterplanung mit den ECTS- Punkten jonglieren. Durch zwei Studien kommen sie häufig über die Mindeststudiendauer hinaus und müssen Studiengebühren entrichten. Damit sie für ihr Interesse an zwei Fachgebieten nicht bestraft werden, refundiert das Wissenschaftsministerium die Gebühren. Vorausgesetzt es werden pro Studium 15 Punkte im Semester absolviert. Ein bürokratisch ohnehin schon aufwendiges Doppelstudium wird durch diese Vorgabe zusätzlich erschwert. Noch-WU- Rektor Christoph Badelt überlegt gar „Prüfungsinaktive“, also Studierende, die unter 16 Punkte im Semester absolvieren, von der Uni zu schmeißen. Angesichts solcher willkürlichen Regelungen, die nur wenig Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse nehmen und deren Nichteinhaltung massiv sanktioniert wird, verwundert eines nicht: In vielen Studierendenforen gibt es dutzende Threads über ECTS-Punkte, die sich möglichst leicht verdienen lassen.

CAN’T GET NO SATISFACTION. Eines der großen Ziele des Bologna-Prozesses war es, die Mobilität der Studierenden zu fördern. Sie sollten es leichter haben, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, aber auch im eigenen Land zwischen den Hochschulen zu wechseln. Kehrt man aus dem Auslandssemester in Reykjavík, Zagreb oder Edinburgh an die eigene Uni zurück, sollten die erbrachten Leistungen durch das einheitliche Punktesystem theoretisch ganz einfach an der Heimatuni angerechnet werden. In Wahrheit ziehen jedoch viele nach dem Erasmus-Aufenthalt ein eher nüchternes Resümee. Laut letzter Studierendensozialerhebung haben etwa 26 Prozent der Studierenden Probleme bei der Anrechnung ausländischer Zeugnisse.
Die Mühlen der Uni-Bürokratie hat auch Rita Korunka durchlaufen müssen. Im Zuge ihres Masterstudiums der Politikwissenschaft an der Universität Wien hat sie 2013 über das Erasmus-Programm ein Semester in Kopenhagen verbracht. Ganz wie vorgesehen hat Rita ein „Learning Agreement“ abgeschlossen. Darin wird festgehalten, welche Kurse an der Gastuni besucht werden. Außerdem kann man so vereinbaren, welche Kurse zuhause angerechnet werden. „Von den 42 ECTS, die ich in Kopenhagen absolviert habe, wurden mir gerade mal zehn angerechnet“, sagt Rita. Die zuständige Person am Institut habe die Anrechnung verweigert, weil Rita in Kopenhagen für zwei Seminare nur ein „absolviert“ statt einer Note bekommen hat. Ein Sprachkurs, den Rita in Kopenhagen besucht hat und der im Learning Agreement stand, wurde genauso wenig anerkannt. „Das Learning Agreement wird nicht ernst genommen. Im Endeffekt hängt es von den einzelnen Erasmus-BetreuerInnen ab, welche Leistungen du angerechnet bekommst.“
Dass ein Semester im Ausland seine Tücken hat, hat sich anscheinend herumgesprochen. In den hübsch aufgemachten Mobilitätsstatistiken zur viel beschworenen internationalen Mobilität werden die Balken, die die Erasmus-AbenteurerInnen repräsentieren, zwar jedes Jahr höher. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich jedoch, dass der relative Anteil – gemessen an der Gesammstudierendenzahl – seit 2009 wieder rückläufig ist. So bleiben jedes Jahr hunderte Erasmus-Plätze frei.
Konstanze Fliedl, Professorin für Germanistik an der Universität Wien, konstatiert im Aufsatz „Entrüstung in Bolognien: Zur Hochschul- und Studienreform“ (siehe Lesetipp), dass das Vorhaben der gesteigerten Mobilität durch Bologna gescheitert sei. Ganz im Gegenteil zu ihren hochgesteckten Zielen habe die Bologna-Reform durch die straffen Studienpläne und die Anrechnungsprobleme mehr Mobilitätshindernisse geschaffen.
Doch nicht nur bei der Anrechnung über Grenzen hinweg liegt vieles im Argen. Felix, der lieber anonym bleiben will, gelang es etwa erst mit Hilfe der Rechtsmeinung einer Juristin, seine Uni von der Rechtmäßigkeit seiner Anrechnung zu „überzeugen“. Die Studienabteilung wollte pauschal eine Lehrveranstaltung nicht anrechnen, weil sie Teil der Studieneingangsphase ist. Warum die Grundlagen der Mikroökonomie an der BOKU anderen Gesetzen folgen sollte als die Einführung in die Volkswirtschaftslehre an der JKU Linz konnte nicht begründet werden. Dabei hatte Felix sogar den Lehrenden auf seiner Seite, der meinte, dass es wohl sinnlos wäre, dasselbe nochmal zu lernen.
Was durch die ECTS-Punkte einfacher und einheitlicher funktionieren soll, entscheiden also erst recht wieder einzelne Hochschulen und verantwortliche Personen nach eigenem Gutdünken.

LOSING MY RELIGION. Doch selbst wenn das System einwandfrei funktionieren würde, wenn sämtlicher Aufwand für die Studierenden punktgenau, individuell und leistungsgerecht abgebildet werden könnte, wenn Anrechnungen so gut funktionieren würden, wie es die Theorie vorsieht, selbst dann bleibt ein massiver Kritikpunkt am ECTS-System. Und zwar jener, der sich gegen die Messbarkeit und Vergleichbarkeit, schlussendlich gegen die Warenförmigkeit von Bildung an sich richtet.
Ungewohnt scharfe Worte kommen dabei von jemandem, der mit dem Bologna-System bestens vertraut ist. So nennt der ehemalige Wissenschaftsminister und ÖVP-Wissenschaftssprecher Karlheinz Töchterle in einem Gastkommentar in Die Zeit die Entwicklungen rund um die ECTS-Punkte einen „Wahnsinn, dem da ganz Europa anheimfällt“. Er spricht von der „Untauglichkeit der Messung“ durch die „Währung“ ECTS-Punkte. „Die einem Thema gewidmete Zeit sagt wenig über den damit verbundenen Studienerfolg aus. Relevant ist der Grad des Könnens und Wissens, aber nicht, wie viel Zeit man dafür verwendet hat“, so Töchterle. Auf Nachfrage von progress präsentiert er ein Gegenkonzept: „Was am Ende des Studiums ge- konnt und gewusst werden soll, wird definiert – der Weg dahin bleibt den Studierenden frei überlassen. Man würde auf ein Großes und Ganzes hin studieren, nicht kleinste Portionen in sich hineinwürgen, um sie dann wieder vergessen zu dürfen.“
„Aber“, so schließt Töchterle gleich im Anschluss an, „das alles ist Utopie und scheint mir völlig unrealistisch, weshalb ich weder als Rektor noch als Minister eine Umsetzung versucht habe. Nicht einmal die Studierenden als Betroffene erwartete ich mir hier als Verbündete. Auch sie wollen eben gerne ‚abhaken‘.“ Er spricht damit ein grundsätzliches Dilemma an, das auch Konstanze Fliedl beschreibt: „Nach einer Phase der geduldig vorgetragenen Einwände oder des ungehaltenen Protests setzt die Resignation ein. Und, vor allem: das Mitmachen. Die Bologna-Reform und zahlreiche Studienreformen haben sich als eine gallertartige Masse herausgestellt, in die wir versunken sind.“
ANOTHER BRICK IN THE WALL. Und in dieser haben sich auch viele Studierende scheinbar zurechtgefunden. Das ECTS-System ist zum Werkzeug der Fremd- und Selbstanalyse geworden und das ist in Zeiten der allgegenwärtigen Selbstvermessung, des ständigen Sammelns, Teilens und Vergleichens auch willkommen. Die vermeintlich neutralen Leistungs- punkte lassen nicht nur die Studierenden, sondern auch zukünftige ArbeitgeberInnen auf einen Blick erkennen, was ihr Gegenüber schon geleistet hat. Die Employability ist mit Bologna zur Priorität im Hoch- schulwesen geworden, gekrönt durch die imaginäre „Währung ECTS“.
Das Mitmachen und das wohlige Gefühl in der Masse scheint trotz mancher Kritik von Studierenden, Lehrenden, WissenschaflerInnen und selbst BildungsexpertInnen zu überwiegen. Ein erster subversiver Akt wäre vielleicht, die Frage „Wie viel ECTS hast du heuer gemacht?“ aus den Köpfen zu streichen und stattdessen zu fragen: „Was habe ich eigentlich gelernt?“
Rosanna Atzara und Klemens Herzog studieren Journalismus und Neue Medien an der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien.
Lesetipp:
„Empörung! Besichtigung einer Kulturtechnik. Beiträge aus Literatur- und Sprachwissenschaft“. Herausgegeben von Alexandra Millner, Bernhard Oberreither, Wolfgang Straub. Wien, facultas Verlag, erscheint 2015.