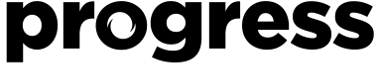Das psychologische Bedürfnis, Dinge zu besitzen und in Anspruch zu nehmen, kann auch dazu genutzt werden, positive Veränderungen zu bewirken.
Was macht ein Umweltpsychologe eigentlich? Diese Frage wird mir oft als Erstes gestellt, wenn ich mich neuen Leuten vorstelle. Während dem Studium war die erste Frage noch „Psychologie? Das heißt, du bist bestimmt gut darin, Leute zu durchschauen? Bitte analysiere mich nicht!“ Im Gegensatz zur Angst gegenüber meinen vermeintlichen hellseherischen Fähigkeiten, ist die Frage zur Umweltpsychologie mehr als berechtigt. Eine offensichtlichere Diskrepanz zwischen zwei Themen (Umwelt vs. Psyche) gibt es in kaum einem Arbeitsfeld.
Die kurze Antwort auf die Frage lautet: Die Stadt- und Umweltpsychologie befasst sich mit der Interaktion zwischen Menschen und ihrer gelebten Umwelt. Die ausführlichere Antwort ist eher: Die Stadt- und Umweltpsychologie regt uns zum Umdenken an. Es geht im Endeffekt nicht um Geist vs. Materie, oder um Mensch vs. Umwelt, oder gar um Stadtplanung vs. Stadtleben. Indem wir Menschen und die Städte, in denen sie leben, holistischer betrachten, können wir nicht nur unsere Städte verbessern, sondern im Umkehrschluss auch unsere Lebensqualität. „Was macht ein Umweltpsychologe also jetzt eigentlich?“ Im Falle dieses Artikels versucht er zum Denken und Tun anzuregen und zu vermitteln, wie sich jede einzelne Person ihre Stadt aneignen kann.
Was ist überhaupt eine Stadt? Gar keine so einfache Frage, für etwas, das wir oft für selbstverständlich halten. Eine dichte Ansammlung an Gebäuden heißt es oft. Sie lässt sich aber auch als eine dichte Ansammlung an Menschen beschreiben. Eine Stadt besteht nämlich nicht nur aus Gebäuden und Straßen, sie besteht vielmehr aus den Menschen, die in ihr leben und arbeiten.
Unsere Umwelt prägt uns dabei genauso sehr, wie wir sie prägen, wodurch Städte über die Zeit hinweg einen Charakter und ein eigenes Wesen entwickeln. Es wird zum Beispiel gesagt „Wien ist anders“. Aber was heißt das? Wien gilt oft als grantig und lebenswert zugleich und unterscheidet sich von anderen Städten auf den ersten Blick. Hinter solchen Stereotypen verbirgt sich oft ein grundlegendes Gespür für unsere gebaute Umwelt.
So unterschiedlich, wie Städte oft dargestellt werden, sind sie dann im Endeffekt aber auch wieder nicht. Städte müssen nämlich alles auf einmal können und sind dadurch oft so divers, dass sie auf den ersten Blick einheitlich erscheinen. Hinter Reihen um Reihen an Häuserwänden treffen viele Menschen und Bedürfnisse aufeinander. Sie alle brauchen Platz; sie alle brauchen Raum. Der Besitz und die Inanspruchnahme von Raum sind ein ewiges Dilemma, das sich unter anderem in den hohen Mietpreisen in Städten bemerkbar macht. Auch kommt es immer wieder zu Konflikten. Diese sind an und für sich nicht automatisch etwas Negatives, denn Konflikte sind ganz normal, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Wie mit diesen Spannungen jedoch umgegangen wird, macht den Unterschied zwischen einer gut und einer schlecht funktionierenden Stadt aus. Räume müssen also kontinuierlich ausverhandelt werden: durch demokratische Prozesse, partizipative Stadtentwicklung, oder über informelle Wege.
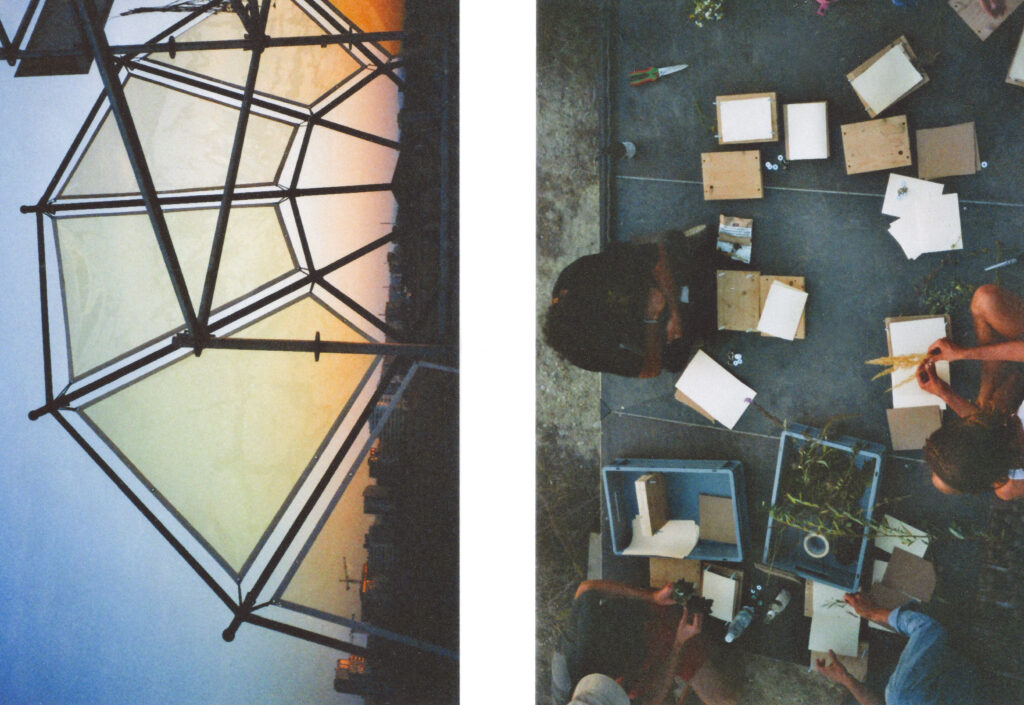
UNSERE Stadt. Die Stadt gehört also niemandem und jedem zugleich. Sie gehört genauso dir, wie auch mir. Das ist gut so, denn um Dinge, die einem gehören, muss man sich auch kümmern. Besitzanspruch wird in unserer kapitalistischen Gesellschaft oft schädlich ausgelebt, doch er kann auch positive Auswirkungen haben. Man spricht in diesem Kontext oft vom Prinzip der „Aneignung“. Sich etwas zu eigen zu machen bedeutet dabei, auf etwas Einfluss auszuüben, sich darum zu kümmern, Vertrauen und Bindung herzustellen und sich letztlich damit zu identifizieren. Aneignung gehört zu unseren grundlegenden Bedürfnissen (Maderthaner 1995).
Es ist oft der erste Schritt, um Veränderung in einer Stadt herbeizuführen. Wenn Menschen wenig Chancen geboten werden, sich ihre Stadt anzueignen und sich in das Geschehen dieser einzubringen, dann nehmen sie die Stadt auch nicht als ihre eigene wahr. In solchen Fällen ist eine Stadt nichts weiter als ein toter Ort, in dem man zwar lebt, aber der sich nur von oben herab, durch wirtschaftliche Gegebenheiten und politische Entscheidungen, verändert. Es ist ein triste und graue Realität — eine, die man zum Glück nicht hinnehmen muss. Ein jeder hat das Recht, seinen Platz in der Stadt zu beanspruchen und gehört sowie gesehen zu werden. Aus einer Person kann dann schnell eine Gruppe, und aus einer Gruppe eine Bewegung werden.
Eine Stadt muss bunt sein. Das betrifft einerseits die Stadt selbst. Sie darf nicht nur dreckig und grau sein, sie muss auch grün und blau sein. Während es sich bei Grünräumen um Orte mit ausreichend Bepflanzung handelt, beschreibt blaue Infrastruktur Orte mit offenem Wasser. Beide wirken sich positiv auf das Klima einer Stadt aus, aber sie haben auch beide einschlägige Effekte auf unsere Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden (siehe zum Beispiel White et al., 2021). Für unser soziales Wohlbefinden sind jedoch auch Städte wichtig, deren Einwohner_innen bunt sind. Obwohl bekannt ist, dass Ähnlichkeiten für den sozialen Zusammenhalt und gesunde Nachbarschaften wichtig sind, wissen wir auch, dass der Kontakt zwischen möglichst diversen Gruppen für eine funktionierende Gesellschaft wichtig ist. Während Ähnlichkeiten in Alter, Beruf, sozialer Schicht und Freizeitinteressen dazu führen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und sich einfacher kennenlernt, stellen andererseits lebensweltliche und soziale Unterschiede eine Stadt auf die Probe. Diversität führt zu Spannungen, aber ist gleichzeitig ein Motor für Veränderung. Es sind hier oft Randgruppen und Minoritäten, die eine Stadt vorantreiben. Besonders junge oder alte Gruppen prägen das Stadtleben, denn vor allem Kinder/Jugendliche und Pensionist_innen verbringen, durch ihre oft eingeschränkte Mobilität, viel Zeit in ihrer Nachbarschaft und haben auch die Zeit, sich in dieser einzubringen.
Stadtpsychologin Cornelia Ehmayer-Rosinak schreibt etwa „Vulnerable Gruppen führen zu einer Art Paradoxon in der Stadtentwicklung: Je mehr vulnerable Gruppen im öffentlichen Raum sichtbar sind, desto resilienter wird eine Stadt. Das Ausschließen von vulnerablen Personen aus dem öffentlichen Leben schwächt den sozialen Zusammenhalt und behindert das Entstehen von gesunden Nachbarschaften.“
Indem sich möglichst viele Menschen und Gruppen ihre Stadt aneignen können, wird also eine bessere Stadt für alle geschaffen. Das Verdrängen von Obdachlosen, Jugendlichen und anderen, manchmal weniger gern gesehenen Gruppen, schwächt eine Stadt nur. Ein gut ausgebautes soziales Netzwerk zieht sich unsichtbar quer durch eine Stadt und ist daher genauso wichtig wie ein gut ausgebautes Verkehrsnetzwerk.
Aneignen, aber wie? Alles schön und gut, aber wie sieht Aneignung in der Realität aus und wie kannst auch du dich an deiner Stadt beteiligen? Die Optionen sind so vielfältig, dass jede ihren eigenen Artikel füllen könnte. Aus diesem Grund folgt an dieser Stelle einfach nur eine kurze Auflistung, die inspirieren soll und bei der hoffentlich für jeden etwas dabei ist:
Urban Gardening, Guerilla Gardening, Guerilla Knitting, Tactical Urbanism, Graffiti & Street Art, Geocaching, Flashmobs, Silent-Discos (und andere öffentliche Feiern), Grassroots-Projekte, Vereine und vieles mehr. Aneignung darf jedoch nicht nur im Kleinen erfolgen. Viele Städte haben ihre eigenen Anlaufstellen, über die man versuchen kann, seine eigenen Projekte zu starten oder positive Änderungen herbeizuführen. In Wien gibt es hierzu beispielsweise die Lokale Agenda, die Grätzloasen fördert.
Mit offenen Augen durch die Stadt. Als Kind und Jugendlicher waren mir meine ganzen Optionen nicht bewusst. Ich war ein ziemlicher Stubenhocker und die Stadt hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Warum auch? Zuhause und mit Freunden konnte ich schließlich entscheiden, was, wo, wie, und wann passiert. Ich dachte mir „Was in der Stadt läuft, haben die Erwachsenen zu regeln“, und ich hatte eine recht gering empfundene Selbstwirksamkeit. „Die Jugend ist an den Jungen verschwendet“, heißt es manchmal. Damit dies nicht passiert, muss Aneignung und Beteiligung gelernt sein. Menschen müssen zuerst unterschwellig erfahren, dass es überhaupt möglich ist, sich in ihrer Gemeinschaft einzubringen. Die Auswirkungen, einer Schulklasse zu erlauben, den Platz vor ihrer Schule zu gestalten, können dadurch weitreichender sein, als man sich am Anfang denken würde. Projekte wie die Kinderuni in Wien und ihre Stadt der Zukunft sind Beispiele, wie bereits versucht wird, Kinder an ihrer Zukunft mitwirken zu lassen. Vielleicht hast du als Kind bereits solche Aktionen miterlebt, vielleicht auch nicht. Falls nein, es ist niemals zu spät, urbane Erfahrungen nachzuholen. Eine einfache Art, die Stadt tiefer zu erkunden, ist zu versuchen, sie mit neugierigem Blick bewusst wahrzunehmen und systematisch über sie nachzudenken. Du findest hierzu beispielsweise eine Anleitung für einen Empirischen Stadtspaziergang (ESP, STADTpsychologie) online. Dieser kann einem als Stütze dienen, einen Ort bewusst zu erleben. Was sehe ich, was rieche ich, was fühle ich? Städte haben viel zu bieten, man muss sie nur bewusst wahrnehmen.
Aneignung → Partizipation → Demokratie. Da die Stadt uns allen gehört, sollte sie auch durch uns alle weiterentwickelt werden. Ein Schritt, der über Aneignung hinausgeht, ist die partizipative Stadtentwicklung. Hierbei können die Nutzer_innen einer Stadt aktiv an der Entwicklung dieser mitentscheiden. Es ersetzt das Mitbestimmen durch Wahlen aber auf keinen Fall und sollte auch nie als Ersatz für politische Mitbestimmung gesehen werden. Nichtsdestotrotz gehört partizipative Stadtentwicklung zu einer gut funktionierenden Demokratie dazu. Es fängt klein an: ein Graffiti an einer Straßenkreuzung, oder ein Flohmarkt in der Nachbarschaft. Indem wir uns bewusst werden, dass es unsere Nachbarschaft, unsere Stadt, unser Land und unser Planet ist, können wir alle selbstwirksam Verantwortung für unsere Erde übernehmen. Mit einem Wort: die Zukunft gehört angeeignet.
Quellenbox:
- Maderthaner, R. (1995). Soziale Faktoren urbaner Lebensqualität. In A. Keul (Hrsg.), Wohlbefinden in der Stadt (S.172-197). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- White, M.P., Elliott, L.R., Grellier, J. et al. Associations between green/blue spaces and mental health across 18 countries. Sci Rep 11, 8903 (2021).
Zitat Cornelia Ehmayer-Rosinak:
www.instagram.com/stadtpsychologie/
Empirischer Stadtspaziergang (ESP):
stadtpsychologie.at/empirischer-spaziergang/
Addi Wala hat Psychologie studiert und arbeitet nun als Stadtpsychologe in Wien.