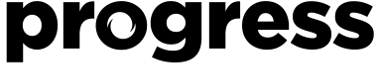Digitale Medien haben den Schulunterricht verändert. Von einer Pädagogik 2.0 ist Österreich aber noch einige Schritte entfernt.
Knetfiguren sitzen in einer Schulklasse. SchülerInnen aus Plastilin sitzen brav an ihren Bänken und schauen geradeaus Richtung Lehrer. Der Pädagoge mit Krawatte und Zeigestock hat vor sich auf dem Pult zwei aufgeklappte Bücher liegen. Auf der Tafel steht „Schulraumkultur“ geschrieben. Daneben hängt eine Uhr. Es ist kurz vor 12.
Den Stop-Motion-Animationsfilm „In Colour“ drehten drei Zweit-Klässlerinnen eines Innsbrucker Gymnasiums und bekamen dafür den media literacy award (mla), eine Auszeichung für Medienkompetenz. Im Theater DSCHUNGEL WIEN wurden mit dem mal heuer zum 13. Mal die einfallsreichsten medienpädagogischen Projekte an europäischen Schulen gewürdigt. „Solche Gestaltungsprozesse erfordern Kreativität“, sagt Dietmar Schipek, Initiator des mla und Chefredakteur von mediamanual.at, einer Plattform des Bundesministeriums für Bildung und Frauen zur Förderung aktiver Medienarbeit an Schulen. Schipek sieht als wichtiges Kriterium für gelungene Medienbildung kritisches Denken: „Es ist ein kreatives Werkzeug, das unabdingbar für Lernprozesse und persönliche Weiterentwicklung ist.“
Medienkunde statt Deutsch. Ein kompetenter Umgang mit Medien verfolge außerdem den emanzipatorischen Anspruch, Menschen aus entmündigenden und entfremdenden Verhältnissen zu befreien, sagt Christian Swertz, der als Professor für Medienpädagogik an der Universität Wien forscht und lehrt. Swertz fordert Medienkunde als Unterrichtsfach – und zwar ab dem Kindergarten: „Wenn ich das mal ganz provokativ sage: Medienkunde sollte eigentlich Deutsch ersetzen.“ Er meint, man müsse nicht nur Bücher, sondern auch Computerspiele und Online-Plattformen lesen können. Als Bezeichnung für diejenigen, die von Anfang an mit moderner Informationstechnologie aufwachsen, prägte der US-amerikanische Autor Marc Prensky den Begriff „Digital Natives“. Ihm zufolge wären Swertz und die meisten LehrerInnen „Digitale EinwanderInnen“. Auch LehrerInnen nutzen trotzdem das Internet; viele von ihnen schauen zur Unterrichtsvorbereitung in die Wikipedia. Die sei mittlerweile aber so elaboriert, dass SchülerInnen lieber
Youtube-Videos anschauen, erzählt Swertz. Material zur Vorbereitung auf den Unterricht könnten den SchülerInnen aber auch sogenannte MOOCs (Massive Open Online Courses) zur Verfügung stellen. MOOCs sind E-Learning-Veranstaltungen, die im Gegensatz zu Kursen auf der Plattform Moodle allen an der jeweiligen Bildungseinrichtung Eingeschriebenen offen stehen. Ein erster MOOC ging heuer in Österreich online: iMooX von der TU und Uni Graz.
„Eine größere Plattform aus Österreich ist mir nicht bekannt“, sagt Jörg Hofstätter, geschäftsführender Gesellschafter von ovos, einer Firma, die interaktive Lernspiele entwickelt. Ihr größtes Projekt ist das Physiklernspiel „Ludwig“, das erste Computerspiel überhaupt, das in Österreich als Unterrichtsmittel eingesetzt wird. Hofstätter würde sich wünschen, dass der Staat und die Bildungsverlage mehr in MOOCs investieren und diese weiter ausbauen. Sonst könnten private Unternehmen den PädagogInnen irgendwann vielleicht ein besseres Angebot machen.
In den USA entwickelte Amplify Learning gemeinsam mit Intel Education ein Tablet speziell für den Schulgebrauch, mit erhöhter Robustheit, einem Stift, Apps, Games sowie dem gesamten Lehrplan vom Kindergarten bis zum High-School-Abschluss. „Amplify Learning ist aber in Besitz von Medienmogul Robert Murdoch“, gibt Hofstätter zu bedenken.
Wettlauf um Bildungstools. Dass ein Privatunternehmen über die Daten zigtausender Schülerinnen und Schüler verfügt, sieht Hofstätter nicht als das einzige Problem an. „Die Firma hat 1.200 Mitarbeiter. Rupert Murdoch macht das nicht aus Charity-Gründen. Ich glaube, er setzt bis zu einem gewissen Grad darauf, dass Bildungsverlage die Transformation vom Buch zu digitalen Inhalten nicht zeitgerecht oder nicht richtig machen.“ Das hält auch Erika Hummer für möglich. Die E Lehrerin an einer Wiener AHS und Koordinatorin diverser E-Learning-Projekte hat einen guten Überblick über die Praxis digitaler Mediendidaktik in Österreich. Sie sagt, unter den Schulbuchverlagen herrsche starke Konkurrenz, weshalb kaum Kooperationen zustande kämen. „Und auch die End- UserInnen – zum Beispiel die LehrerInnen – haben überhaupt keine Möglichkeit, hier mitzugestalten“, erzählt Erika Hummer.
„15 Prozent von dem Geld, das Schulen für Schulbücher bekommen, dürfen sie für digitale Medien ausgeben. Das ist ziemlich wenig“, sagt Hummer: „Und noch dazu muss in der Schule Konsens herrschen, damit etwas angeschafft wird. Das durchzusetzen, kann schon mal ein richtiger Kampf sein.“ Erschwerend kommt hinzu, dass Pflichtschulen seit Kurzem für die Nutzung von Moodle zahlen müssen, sagt Hummer. Trotz der Schwierigkeiten gibt es aber sehr vielversprechende Initiativen in Österreich, beispielsweise eLSA, KidZ und das Klassenzimmer der Zukunft.
Das Tablet auf der Schulbank. In den 200 Schulen, die Hummer selbst betreut, gibt es 25 Tablet-Klassen. Die Geräte werden geleast, von der Schule angeschafft, von SchülerInnen mitgebracht oder mithilfe gegenseitiger Unterstützung beschafft, falls sich die Eltern kein Tablet leisten können, weiß die Projektkoordinatorin. Das Bedürfnis nach Technik werde immer größer. Sie bekommt ständig Anfragen von Schulen, die sich auch Tablets zulegen wollen. Laut der Expertin für E-Didaktik schreiben die Lehrpläne die Arbeit mit digitalen Medien sogar vor, was in der LehrerInnenausbildung jedoch nur wenig Beachtung finde. „Wenn sich Lehrerinnen und Lehrer endlich dazu überwinden, mit digitalen Medien zu arbeiten, dann reflektieren sie auch ihre Rolle“, meint Hummer: „Weil dann sind sie nicht mehr die InformationsgeberInnen und WissensvermittlerInnen. Sie werden MotivatorInnen, Coaches, Menschen, die Impulse nehmen und von Schülern und Schülerinnen lernen.“
Jonas Kühnapfel studiert Journalismus und Neue Medien an der FH Wien.