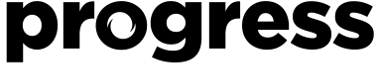progress: Könnt ihr euch an eure erste Begegnung
mit Volksmusik bzw. Volkstanz erinnern?
Hanna Góral: Ganz genau kann ich mich daran
jetzt nicht mehr erinnern. Ich war bestimmt ein
kleines Kind im Vorschulalter. Ich kann mich aber
an meinen ersten Tanzunterricht in der Grundschule
erinnern, zu dem mich damals meine Eltern geführt haben. Dort haben wir gelernt, unseren ersten
Volkstanz zu tanzen.
Alicja Zell: Ich kann mich an solch eine Begegnung
nicht erinnern, bestimmt nicht bewusst. Ich glaube, dass alles in der Musikschule begonnen hat. Ich
habe den Klavierunterricht in unserer städtischen
Musikschule besucht, wo ich in Kontakt mit Volksmelodien gekommen sein muss. Wir hatten auch
Tanzunterricht in der Schule, bei dem wir Volkstänze gelernt haben.
progress: Kann es sein, dass ihr noch früher in
den Kontakt mit der Folklore treten konntet? Hat
ein Familienmitglied etwa Volkslieder gesungen
oder wurden Volkstänze während eines Anlasses
getanzt?
H.G.: Nein, gar nicht. Meine Eltern waren schon
musikalisch. Meine Mutter hat Klavier gespielt, mein
Vater hat Gitarre gespielt. Beide waren allerdings
autodidakt in dieser Disziplin. Sogar die Großmutter hat kaum Volkslieder gesungen oder Volkstänze
getanzt.
A.Z.: Das Zuhause war bestimmt der Ort, wo ich
das erste Mal in Kontakt mit Musik getreten bin. Ich
weiß, dass meine Mutter Cello gespielt hat, obwohl
ich mich daran nicht erinnern kann. Sie hat mir
auch viel vorgesungen. Ich glaube, dass das einfache Volksmelodien waren. Meine Großeltern waren
auch musikalisch. Mein Großvater hat Akkordeon
gespielt, meine Großmutter hat viel gesungen. Ich
denke mir gerade, was sonst hätten sie singen können, wenn nicht gerade Volkslieder?
progress: Wie sieht die Arbeit in einem institutionalisierten Ensemble für Volksmusik und Volkstanz
aus?
H.G.: Die Gruppe von Menschen, die aus den unterschiedlichsten Milieus kommen und die diese
Leidenschaft für Folklore verbindet, probt und tritt
in solch einem Ensemblemeistens unbezahlt auf.
Gewöhnlich gibt es in solchen Ensembles zwei Gruppen: eine Chorgruppe und eine Ballettgruppe. Im
Ensemble „Wrocław“ (Breslau), wo ich meine ersten
professionellen Erfahrungen gemacht habe, habe ich
lediglich die Ballettgruppe besucht.
A.Z.: Die Arbeit in solch einer Tanzgruppe hat in
der Gesangs- und Bewegungsbildung bestanden, d.
h. wir haben uns zwei Mal wöchentlich getroffen,
wobei eine Hälfte des Unterrichts dem Gesangsunterricht am Klavier, die zweite Hälfte des Unterrichts dem Tanz gewidmet war. Ich kann mich an
viel Musik und wirklich viel Bewegung erinnern. Die
erste Begegnung eines Kindes mit einem Volkstanz
geschieht während des Tanzspiels im Kreis. Das
ist die wohl einfachste Figur, aber spielt eine sehr
wichtige Rolle bei der Kindererziehung, denn sie
lehrt Integration, Zusammensein und Zusammenarbeit. Ich denke ebenfalls, dass ein sehr wichtiger
Aspekt der Arbeit in solch einer Tanzgruppe das
Miteinbeziehen der Kinder in regionale Traditionen
ist. Es wurden mehrere Volksfeiern organisiert,
die die Menschen in polnischen Großstädten heute
kaum mehr veranstalten werden, wie beispielsweise
Ostatki (poln. „die letzten Tage des Karnevals“) oder
Andrzejki (poln. „Andreasnacht“). Die Kinder haben
die Möglichkeit, während solcher Feiern eine lebendige Folklore zu erfahren, d. h. sie singen ein Volkslied nicht, um zu zeigen, welche Gesangstechniken
sie gemeistert haben, sondern um eine Geschichte
zu erzählen, die in dem Lied versteckt liegt, die vor
Jahrhunderten entstanden ist und die diese Kinder
schlussendlich verstanden haben. Sie werden also
zum Teil einer gewissen Kultur.
progress: Was bedeutet für euch Folklore? Wo ist
ihr Platz heutzutage unter anderen Kunstarten?
H.G.: Folklore hat mich mein Leben lang begleitet
und beeinflusst es noch immer. In Musikschulen, an
Musikuniversitäten habe ich Motive aus der Volksmusik bzw. dem Volkstanz in meinen Auftritten am
Institut für Musik- und Bewegungspädagogik immer
wieder aufgegriffen. Ich habe den Eindruck, dass
wir in einer Zeit leben, in der dieses menschliche
Bedürfnis nach Annäherung an das Originale, an die
Wurzeln immer stärker wird. Seit einiger Zeit beobachtet man ebenfalls die Präsenz volkstümlicher
Motive in der Popkultur. Für mich ist Volkstanz die
tollste Art des Tanzens, weil man solo, als Paar oder
in einer Gruppe tanzen kann.
A.Z.: Folklore ist für mich eine Möglichkeit, sich
selbst auszudrücken. Ich habe in der Folklore, in diesen Melodien, Schritten, Trachten, Zöpfen, im Zusammensein mit Anderen mich selbst wiedergefunden. Ich habe den starken Eindruck, wenn ich einen
Volkstanz aufführe oder die Tracht anziehe, dass ich
mein wahres Gesicht zeige. Vielleicht begebe ich in
eine Rolle hinein, aber ich bin mit ihr im Einklang.
Deine Frage erinnert mich daran, als ich einmal
beim Casting zu „America‘s Got Talent“ in New York
war und mir vorgenommen habe, etwas aus der
polnischen Folklore darzustellen. Tanzen konnte ich
allein nicht. Deswegen habe ich ein Volkslied ausgewählt, das mich ausdrückt. Das Lied handelt von einem jungen Mädchen, das heiraten musste und ihre
Freiheit verloren hat. Ich kenne diese Situation zwar
nicht, weil ich so was niemals erlebt habe, aber ich
spüre, dass mein Alter Ego sie doch kennt. Ich fühle
den Schmerz dieser Frau, kann mich mit ihr identifizieren. Persönlich war ich immer von jeglichen
Freiheitsbewegungen berührt. Ich habe das starke
Gefühl, dass Frauen immer viel zu sagen gehabt
haben, aber aus politisch-soziologischen Gründen
keine Möglichkeit dazu hatten. Durch die Folklore
fühle ich mich, als ob ich diesen Frauen ihre Stimme
zurückgeben würde. Dort in Amerika auf dieser
Bühne habe ich genau das gesungen, was ich dem
Publikum erzählen wollte, über dieses Mädchen, das
einmal etwas erlebt hat. Ich habe die Anwesenheit
ganzer Generationen, die diese Geschichte weitergegeben haben, gespürt. Die Folklore ist für mich eine
Chance, sich anderen Kulturen zu öffnen. Wenn ich
keine Ahnung über meine eigene Kultur hätte, was
könnte ich in andere Kulturen einbringen bzw. was
könnte ich von anderen Kulturen lernen? Wenn ich
mich nicht mit Folklore beschäftigen würde, würde
ich heute auch nicht so viel reisen, hätte ich nicht
die gleiche Wissbegierde. Ich würde nicht wissen,
was ich suche. Dank der Folklore weiß ich, wonach
ich suche, und das ist jedes Mal eine Kultur.
progress: Nach der Absolvierung des Trainer_innenlehrganges für Volkstänze in Krakau habt ihr
euch entschieden, die Volkstanzgruppe „Mazurki“
für kleine Kinder in Wien zu begründen. Was wollt
ihr euren kleinen Schützlingen von Folklore vermitteln, denn ich verstehe, dass es nicht um Hebefiguren und ballettartige Zehentechnik geht?
H.G.: Ich bin stark davon überzeugt, dass Volkstanz eine sehr facettenreiche Grundlage für andere
Tanztechniken bietet. Ich kenne persönlich viele
Menschen, die sich nach dem Volkstanz anderen
Tanzarten gewidmet haben, beispielsweise dem
Gesellschaftstanz, modernem Tanz oder sogar dem
Ballett. Technisch spielt für Kinder die Wiederholbarkeit der Schritte und die Schlichtheit der Melodien eine große Rolle. Was uns aber viel wichtiger
ist als die richtige Technik ist die Vermittlung der
polnischen Kultur an die jüngste Generation. Unsere
Schüler_innen sind Kinder, die sich in einer ganz
anderen Lage als ihre Gleichaltrigen, die in Polen
leben, befinden. Hier in Wien haben sie kaum Chancen, in Kontakt mit polnischer Folklore zu treten.
Entweder können es die Eltern ihnen nicht vermitteln oder es gibt vor Ort keine Institution, die sich
damit befassen würde. Wir wollen, dass „Mazurki“
ein Platz für jedes sowohl polnische als auch nichtpolnische Kind ist, das an der polnischen Kultur
Interesse hat. Schlussendlich ist „Mazurki“ ein Ort
für das gemeinsame Spiel sowie Freude an Musik
und Bewegung.
A.Z.: Das Wertvollste, was die Folklore zu vermitteln
hat, sind meiner Meinung nach Werte. Werte, die
sehr unterschiedliche Lebensaspekte strukturieren,
von der Familie über die Kultivierung der Tradition bis zur Aufgeschlossenheit gegenüber anderen
Kulturen. Kinder können sich natürlich einer anderen
Freizeitgestaltung widmen. Ich habe jedoch den Eindruck, dass man innerhalb einer Volkstanzgruppe intuitiv einen gemeinsamen Nenner finden kann, sprich
eine gemeinsame Kultur, die auf Herkunft zurückgeht. Unsere Volkstanzgruppe hat in meiner Vorstellung auch eine starke Erziehungsfunktion abseits der
Folklore: wir treffen uns regelmäßig, pünktlich um
eine bestimmte Uhrzeit. Wir üben in einer Gemeinschaft, jede_r hat eine Rolle in der Gruppe. Wenn
diese Rolle fehlt, kann die Choreographie nicht ganz
klappen. Was interessant ist, ist die Tatsache, dass
keiner von unseren Schützlingen in Polen geboren ist.
Alle Kinder sind in Österreich geboren und sie sehnen
sich nicht nach Polen, weil sie dieses Land als Heimat
gar nicht kennen. Wir möchten ihnen die polnische
Kultur ein bisschen näherbringen, aber sie auf keinen
Fall damit bombardieren. Wir bemühen uns, ihnen zu
zeigen, dass die polnische Kultur attraktiv und wertvoll ist, da sie Freude und Vergnügen bereiten kann.
Sie kann auch eine gemeinsame Sprache für diese
Kinder sein. Es zeigt sich, dass polnische Volkstanzspiele, polnische Sprache und Kultur eine gemeinsame Bezugsebene haben können.
progress: Wo seht ihr Folklore in Zukunft?
H.G.: Wir leben in der Zeit der Globalisierung.
Dieses Phänomen hat uns viele neue Möglichkeiten
eröffnet. Wir können heute Musik und Kultur aus anderen Ländern und sogar von anderen Kontinenten
erfahren. Auf die eigene Kultur vergisst man oft. Ich
glaube stark daran, dass die Teilnahme an solchen
Volkstanzgruppen Menschen die eigene Kultur
vertrauter machen kann. Ich hoffe, dass es noch
mehr folkloristische Veranstaltungen und Initiativen
geben wird.
A.Z.: Ich erfahre persönlich ein großes Interesse
an der Folklore, nicht nur in Polen oder in Österreich, sondern allgemein auf der ganzen Welt. Es
werden zahlreiche Volksfestivals organisiert, wo
sich verschiedene Volkstanz- oder Gesangsgruppen
aus der ganzen Welt treffen. Man bemerkt auch ein
gesteigertes Interesse an der Volkskultur im Kino.
Ich meine hier z.B. den oscarnominierten Film „Cold
War“ von Paweł Pawlikowski, in dem die polnische Volksmusik den Hintergrund für eine Liebesgeschichte bildet. Wir sehen Volksmotive in der
Mode, wenn bunte Blumenmuster aus traditionellen
Trachten auf tagtägliche Kleidungsstücke überspringen. Wenn es um die Aufführung der Folklore selbst
geht, gibt es heute leider einen starken Trend zur
Stilisierung und ich befürchte, dass dieser Trend in
Zukunft weiter zunehmen wird.