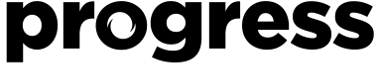Jede fünfte Frau wird von ihrem Partner misshandelt. Das passiert nicht irgendwo, sondern bei uns in Österreich. Gewalt ist Alltag und hat viele Gesichter. Eine europäische Kampagne macht jährlich auf dieses Tabuthema aufmerksam.
Wir trauern um Giuseppina Tolve“ steht in schwarzen Lettern auf der Website eines deutschen Frauenhauses geschrieben. Neben diesen Zeilen das Foto einer lachenden Frau Mitte Dreißig, in grünen Gummistiefeln und einer gestreiften Strickweste. Guiseppina war nach jahrelangem Gewaltmartyrium von ihrem Ehemann in ein Frauenhaus geflohen, hat dort mit ihren zwei Kindern Schutz gesucht und von einem Neubeginn geträumt. Vergeblich, denn Ende Oktober 2007 zerstörte ihr Mann diese Pläne. Er nahm ihr das Leben.
Dieses Frauenschicksal steht für zahlreiche andere. In Österreich wird jede fünfte bis zehnte Frau in einer Paarbeziehung misshandelt. Das sind bis zu 300.000 Frauen jährlich. Die Wiener Polizei schätzt, dass ein Viertel ihrer Einsätze wegen Gewalt innerhalb der Familie stattfinden. Das sind rund einhundert Interventionen täglich.
„Ich bring’ dich um, wenn du mich verlässt!“ Gewalt an Frauen hat viele Gesichter. Es können Beschimpfungen und Bloßstellungen sein, die Frauen erdulden. Schläge und Drohungen, die sie über sich ergehen lassen. Frauen werden zu sexuellen Handlungen gezwungen oder vergewaltigt. Der Partner kann sie von der Außenwelt isolieren oder sie aber ständig beschatten. Die soziale Schicht spielt bei Gewalt keine Rolle: Eine erfolgreiche Karrierefrau kann ebenso wie eine Kassiererin, eine Dame aus gutem Hause genauso wie die erst seit kurzem in Österreich lebende Migrantin betroffen sein.
Gewaltmonopol Staat. „Wir leben in keiner gewaltfreien Kultur, unsere Gesellschaft ist gewaltfördernd“, prangert die Wiener Frauengesundheitsbeauftragte Beate Wimmer-Puchinger die Struktur unserer patriarchalen Gesellschaft an. Die Position der Frau in ihrem sozialen Umfeld spielt eine wesentliche Rolle in der Gewaltentwicklung innerhalb der Familie. Gemeinsam mit der Psychotherapeutin Marianne Springer-Kremser und weiteren Expertinnen hat Wimmer-Puchinger vor wenigen Jahren die Gender-Ringvorlesung „Gewalt im Lebenszyklus der Frau“ am Wiener AKH ins Leben gerufen. Denn die „Folgen von Gewalt machen krank. Das können Depressionen sein, und vor allem Schuld- und Schamgefühle bei Frauen, die Opfer sind“, so Springer-Kremser. Bis sich Frauen dazu entschließen, in einem Frauenhaus Hilfe zu suchen, vergehen oft Jahre. Oder es ist zu spät.
Fluchtstätte Frauenhaus. Rund 1600 Frauen, die von ihren Partnern misshandelt wurden, suchten im Jahr 2006 Schutz in einem Frauenhaus. Im Verein „Autonome Österreichische Frauenhäuser“ sind 25 Einrichtungen vernetzt. Frauenhäuser bieten mehr als nur ein Dach über den Kopf. Sie sind Zufluchtstätten für Frauen und ihre Kinder in Krisensituationen. Hier finden die Opfer Ruhe von der alltäglichen Gewalt und können ohne Druck überlegen, was weiter geschehen soll. Ob sich die Frau vom gewalttätigen Mann trennen möchte oder nicht, obliegt ihr selbst. Das „durchschnittliche Opfer“ von häuslicher Gewalt ist verheiratet, zwischen 20 und 40 Jahren alt und hat einen Pflichtschulabschluss. Der Misshandler ist meist der Ehemann. Manche Frauen verbringen nur ein oder zwei Tage im Frauenhaus, andere bleiben bis nach der Scheidung.
16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, startete die Europakampagne „16 Tage gegen Gewalt“, die weltweit begangen wird und bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, andauert. Verschiedene Fraueneinrichtungen werden in Form von Veranstaltungen auf die Bedrohung der Frau durch männliche Gewalt aufmerksam machen. Es werden Workshops zu Themen wie „Sicher unterwegs“ und Selbstverteidigungskurse angeboten.
„Gewalt gegen Frauen ist kein Kavaliersdelikt und darf niemals toleriert werden. Gewalt dient dazu Macht und Kontrolle über Frauen auszuüben und äußert sich in ungleichen Machtverhältnissen und Lebenschancen“, betont die Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger die wichtige Intention des Projekts.
Karin Jirku studiert Soziologie in Wien und Journalismus an der Fachhochschule Wien.
Der Veranstaltungskalender ist online unter http://www.aoef.at/tage/kalenderframe.htm abrufbar.