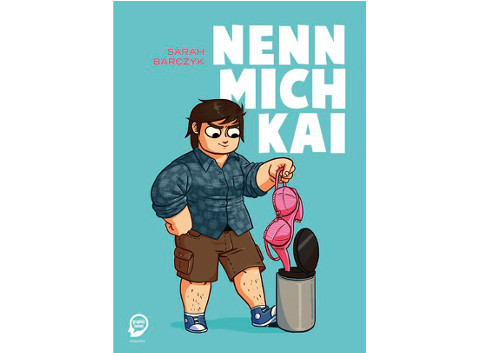Beim diesjährigen „Crossing Europe“-Filmfestival in Linz fand der Dokumentarfilm „Europe, She Loves“ reges Interesse. Im Juni kommt er in die österreichischen Kinos. Marlene Brüggemann hat für progress mit dem Regisseur Jan Gassmann über Paarbeziehungen im EU-Parlament, Routinesex und nationale Nussschalen gesprochen.
progress: Du bist aus der Schweiz. Warum interessierst du dich für Europa?
Jan Gassmann: Genau aus dem Grund. In erster Linie sind wir Schweizer, dann mal Weltbürger und irgendwann vielleicht noch Europäer. Dadurch, dass die EU in einer Schieflage ist, ist die Schweiz in der angenehmen Position, sich raushalten zu können. Trotzdem sollte es eine Mitverantwortung der Schweiz geben. 1992 stimmten die Schweizer knapp gegen eine EU-Mitgliedschaft, seitdem ist dies ein Tabuthema. Die Schweizer gehören aber zum Kern Europas und ich persönlich sehe mich auch als Europäer. Ich las viel über die Krise in der EU, war aber selber nicht davon betroffen. Eine Zeit lang gab es überall Beiträge über die Jugend in der EU, dann plötzlich war das Thema uninteressant und die Artikel blieben aus. Dabei war die Krise, dort wo wir als Filmteam waren, für die Jugend total aktuell. Das war auch die Motivation, „Europe, She Loves“ zu machen.
Im Film gibt es eine starke Diskrepanz zwischen den Nachrichten, die im Radio oder Fernseher liefen und den Reaktionen der vier Paare, die du darstellst. Habt ihr beim Drehen die Nachrichten absichtlich laufen lassen?
Oft hat sich das zufällig ergeben, dass eine Nachrichtensendung lief. Es gibt diese ewige Berieselung und du nimmst die Nachrichten auch wahr, aber du kannst sie nicht richtig verarbeiten. Das was von den Medien kommt, hat einen starken Stellenwert. Gleichzeitig hat man einen kleinen Papierkorb im Kopf, wo alle diese Informationen hineingehen. Denn es sind keine Gesichter mehr dahinter, sondern nur Zahlen. Ich konnte filmen, worüber die Medien berichten. Die Gesichter hinter den Nachrichten zeigen – das war mein Thema.
[[{"fid":"2249","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Regisseur Jan Gassmann","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Regisseur Jan Gassmann. Foto: Marlene Brüggemann"},"type":"media","attributes":{"alt":"Regisseur Jan Gassmann","title":"Regisseur Jan Gassmann. Foto: Marlene Brüggemann","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Eine Meldung ist die Ermordung des antifaschistischen Rappers Pavlos Fyssos durch einen Neonazi der „Goldenen Morgenröte“-in Athen. Woraufhin Penny und Nicolas auf eine Solidaritätsdemo für Fyssos gehen. Wie ist die politische Stimmung in den anderen Ländern, die im Film vorkommen?
In Tallinn gibt es die Spannung zwischen der russischen und der estnischen Community. Die haben sehr wenig miteinander zu tun. Die russische Minderheit will sich wieder Russland annähern, während die Esten einen Zaun an der Grenze zu Russland gebaut haben. In Dublin war vielmehr das Thema präsent, dass die alten Parteien überholt waren und es nur noch Protestparteien gab. Nach dem „Celtic Tiger“ war die Arbeiterpartei total am Boden, die Konservativen beschädigt. Dort waren einfach alle total genervt von Politik. In Sevilla waren die Bürgerbewegungen interessant. Als wir dort waren, war die Frage wichtig, ob die Bürgerbewegungen es ins Parlament schaffen würden. Es gab aber auch andere Themen. Der Bildungsminister José Ignacio Wert hatte alle Erasmus-Zuschüsse gekürzt; auch für die Studierenden, die bereits im Ausland waren. Sie mussten deswegen nach Spanien zurückkehren. Dagegen gab es auch eine Demonstration.
Abschottung ist also ein länderübergreifendes Thema?
Wir sind die erste Generation, die keine Limitierungen hatte. Die Vermischung und dass die Leute sich frei bewegen können, tut uns doch gut. Dass man jetzt wieder zurück muss in seine nationale kleine Nussschale und sich absperrt, das finde ich schrecklich.
Bietet ein Studium den jungen Menschen eine Zukunftsperspektive?
Es ist die Frage, was du daraus machst. Die Unterschiede zeigen sich an Karo und Juan aus Sevilla. Karo hat nach dem Film doch noch einen Masterplatz in Barcelona bekommen. Sie weiß, dass sie das Studium zu Ende bringen muss. Da tut sich ein Zwiespalt auf, weil die Jungen wissen, dass sie einen Abschluss brauchen, um im Ausland einen Job finden zu können. Sie sind aber auch mit ihren Städten und ihrem Land verbunden. Diese EMigration, weil es nicht anders geht, die funktioniert für die meisten innerlich dann doch nicht wirklich. Ich würde dennoch allen empfehlen zu versuchen etwas zu studieren. Andererseits, ist da Juan, der nie studiert hat. Er machte eine Graphikerausbildung, war Gabelstaplerfahrer, Rettungsschwimmer und ist jetzt Security. Seine Eltern sind ebenfalls Securities. Juan ist talentiert, kommt aber aus einer Klasse, bei der es gar nicht zur Diskussion stand, dass er ein Studium beginnen könnte. Seine Position ist noch viel unklarer als die von Karo, weil er überall einsetzbar ist, aber keine Chance hat, sich beruflich zu definieren.
[[{"fid":"2248","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"crossing europe Wand","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Marlene Brüggemann"},"type":"media","attributes":{"alt":"crossing europe Wand","title":"Foto: Marlene Brüggemann","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Die Protagonist_innen arbeiten alle in prekären Jobs als Kellnerin, Tänzerin, Security oder Pizzalieferant. Siobhan und Terry aus Dublin sind arbeitslos. War Arbeit ein Thema?
Am Anfang ging ich thematisch an den Film heran. Ich dachte, die Arbeitssituation ist eigentlich das Wichtigste. Erst während dem Dreh und als ich die Paare besser kannte, habe ich gemerkt, dass die Arbeit zwar ein Teil des Films sein wird, aber ich werde nicht zehn Mal zeigen, wie jemand Pizza ausliefert.
Die Repetition, die auch harte Arbeit charakterisiert, kommt dafür in Bezug auf Sex vor.
Ist es natürlich auch. (Lacht) Normalerweise ist im Spielfilm der Sex immer ein Klimax oder der Anfang von etwas Neuem. Ich versuchte Sex in meinem Film zu demystifizieren und in einen Alltag einzuflechten. Sex als etwas, was man macht, weil er nichts kostet und man halt zusammen ist.
In „Europe, She Loves“ kommen nur heterosexuelle Paare vor. Wie hast du sie ausgewählt?
Wir casteten fast hundert Paare. Dass es die vier wurden, die im Film porträtiert sind, war eine Bauchentscheidung. Wichtig war mir auch die Kombination aus verschiedenen Paaren, deswegen wollte ich auch die estnische Familie mit Veronika und Harri. Die Idee war, die Veränderungen, die man zwischen 20 und 30 durchmacht, darzustellen. In einer Paarbeziehung sucht man gemeinsam einen Kompromiss, eine Zukunft oder eine Entscheidung. Darin spiegelt sich gut, was auch im EU-Parlament in Brüssel passiert. Die kleinen Dinge, die zu einem Zusammenleben beitragen, zeigen sich schön in der Paarbeziehung. Dass es nur heterosexuelle Paare waren, hat sich so ergeben. Außerdem hätte ich es schade gefunden, wenn man im Nachhinein immer die drei Hetero-Paare mit dem homosexuellen verglichen hätte. Da hätte ich dann gern ein schwules oder lesbisches Pärchen gewollt, das nicht noch zusätzlich ein Klischee erfüllt.
[[{"fid":"2251","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Im Abspann spielt das Lied „Europe Is Lost“ von Kate Tempest. Ist Europa verloren?
Für mich ist der Song und das, was er sagt, im Kern sehr positiv. Alles aus dem Film ist darin kondensiert. „Europe Is Lost“ fragt auch danach, wann wir wir endlich wieder aufwachen werden. Ich glaube an Europa- Es ist schade, dass man dem Experiment EU nicht wirklich eine längere Zeit zugesteht, fünfzehn Jahre EU sind nicht lange. Ich bin aber auch nicht super Pro-EU. Es ist eine komplexe Materie, aber man muss dem Konzept eine Chance geben, dass es sich erarbeiten und sich daraus etwas ergeben kann.
Marlene Brüggemann studiert Philosophie an der Universität Wien.